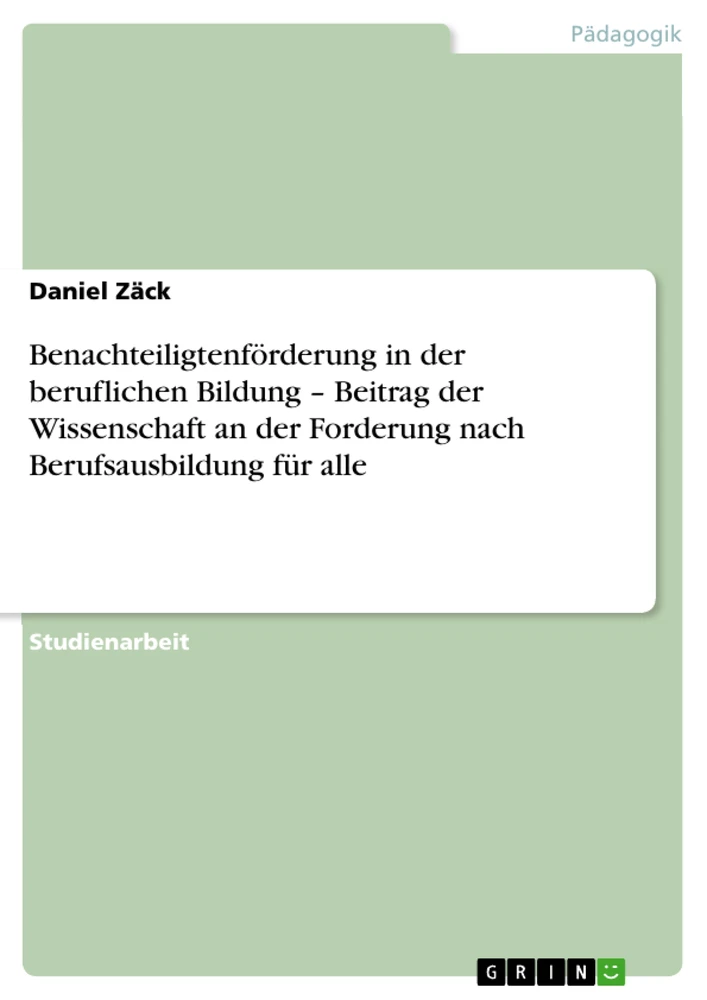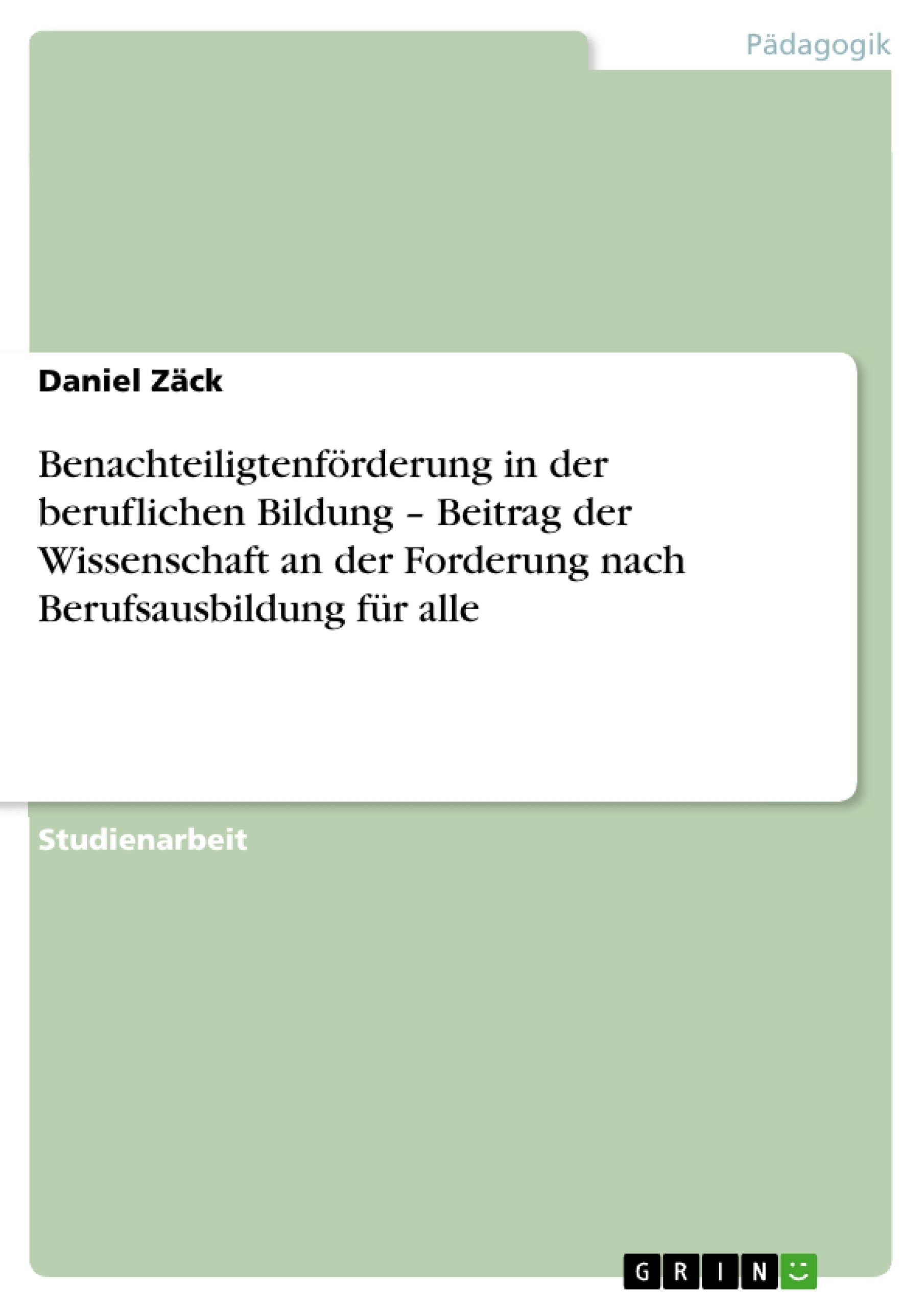Diese Ausarbeitung soll den aktuellen Forschungsstand hinsichtlich einer Reform des sogenannten Übergangsystems, insbesondere im Bereich der Berufs- und Wirtschaftspädagogik skizzieren. Dabei soll die These verfolgt werden, dass mit Hilfe einer grundlegenden Professionalisierung des pädagogischen Personals und moderner Konzeptionen zur Benachteiligtenförderung, Menschen mit einer Beeinträchtigung ein selbstbestimmtes Leben innerhalb einer Gesellschaft ermöglicht werden kann. Neben der Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstands, welcher die angesprochene Thematik behandelt, sollen Problemstellungen und Forschungsfragen herausgestellt werden. Dies soll durch aktuelles Zahlenmaterial unterstrichen werden. Außerdem wird ein Förderkonzept zur Umsetzung von individueller Förderung exemplarisch vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Definition Benachteiligung und Formen von Beeinträchtigung
2.2 Definition Übergangssystem
2.3 Darstellung der aktuellen Problemstellung in der beruflichen Benachteiligtenforschung
2.4 Qualifizierung des pädagogischen Personals
2.5 Vorstellung eines Konzepts zur individuellen Benachteiligtenförderung
3. Schluss
Literaturverzeichnis