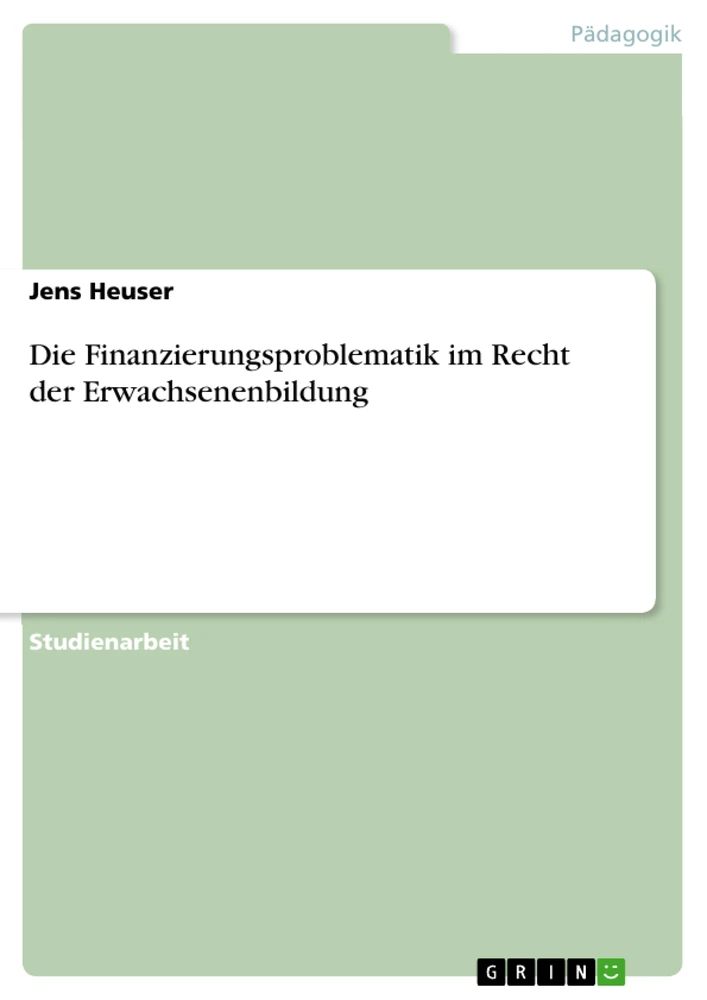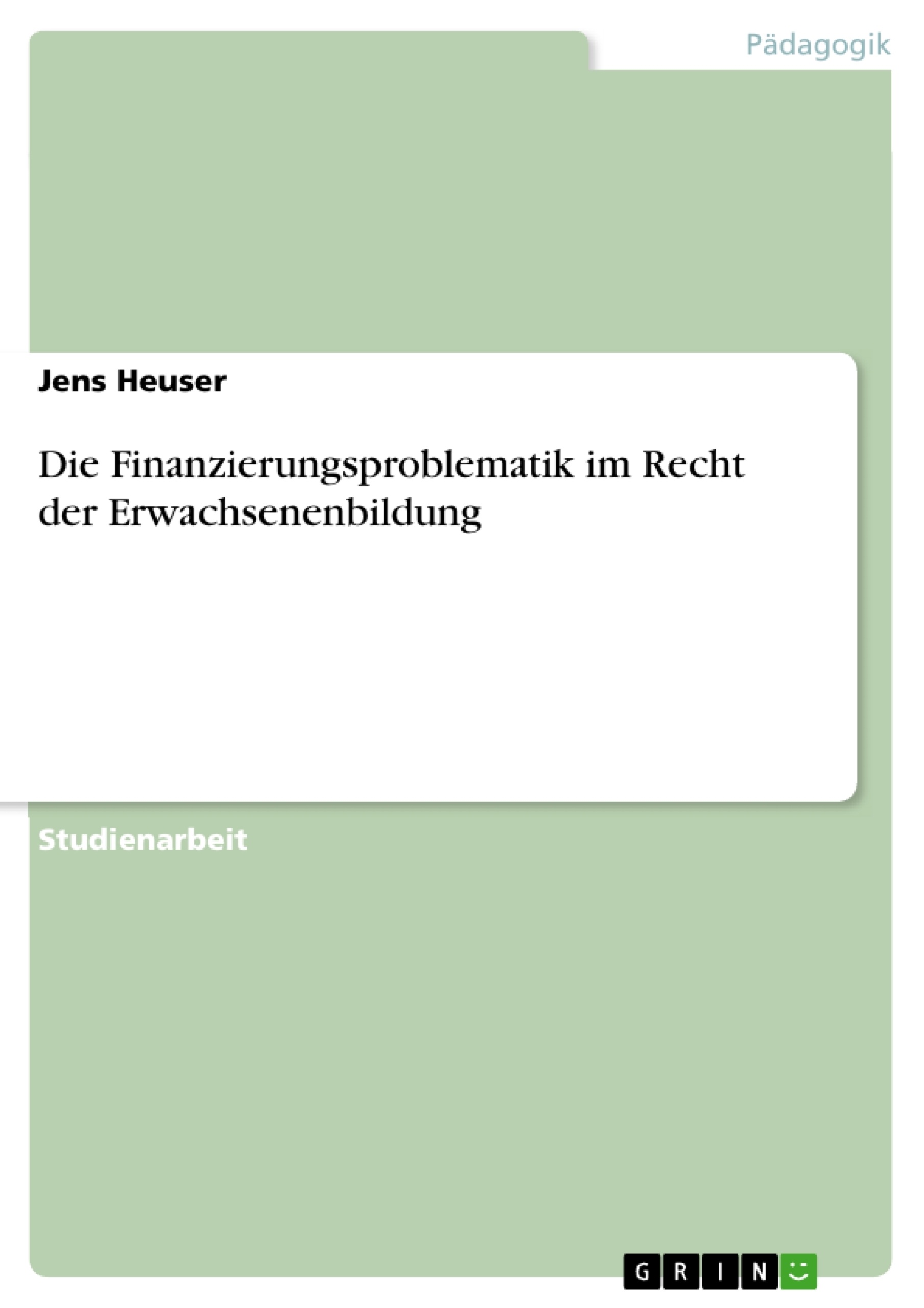Die vorliegende Arbeit soll sich mit den Schwierigkeiten, den Forderungen und den immer neuen Lösungsansätzen in der Problematik der Erwachsenenbildung, genauer deren Finanzierung und rechtlichen Grundlagen, auseinandersetzen. Es soll gezeigt werden, dass die gegenwärtige Situation in Recht und Finanzierung der Erwachsenenbildung an erster Stelle kein Problem der Politik, sondern eines der Disziplin selbst ist: Solange die Erwachsenenbildung keinen festen Platz im Bildungssystem eingenommen hat, werden rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen ständig dem Prozess ihrer Emanzipation angepasst werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die finanzierungsrechtliche Situation in der Weiterbildung
2.1 Gesetzliche Regulierung der Weiterbildung
2.2 Rechtsgrundlagen der finanziellen Förderung
2.3 Das Problem der Kosteninzidenz
2.4 Die Aussagekraft empirischer Daten zur Finanzierung
3 Die Notwendigkeit eindeutiger, einheitlicher Strukturen
Literaturverzeichnis