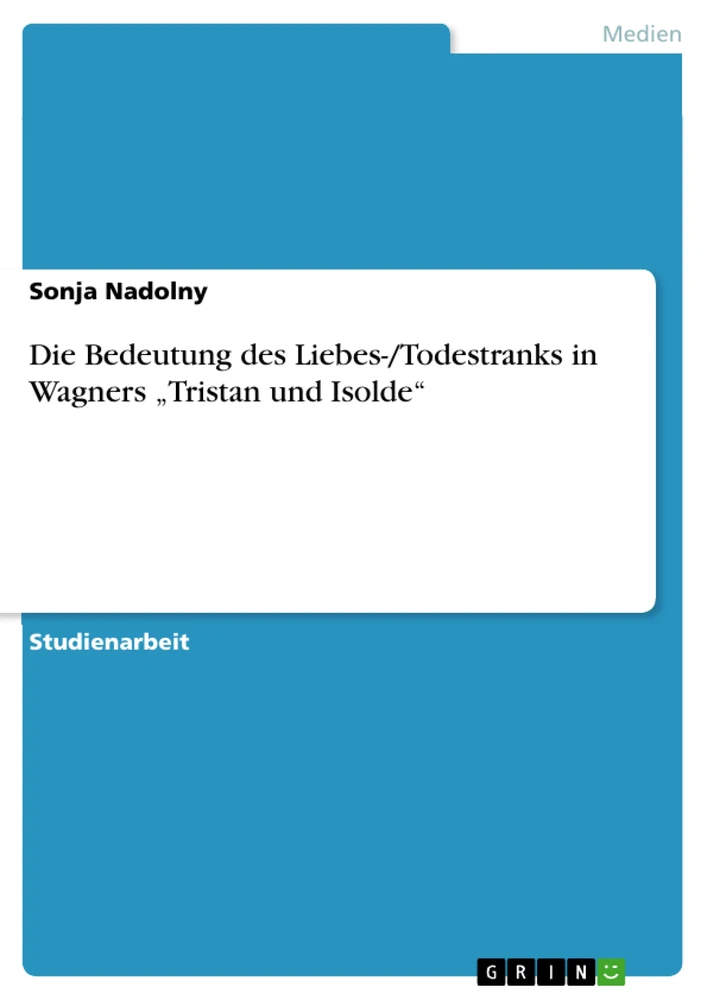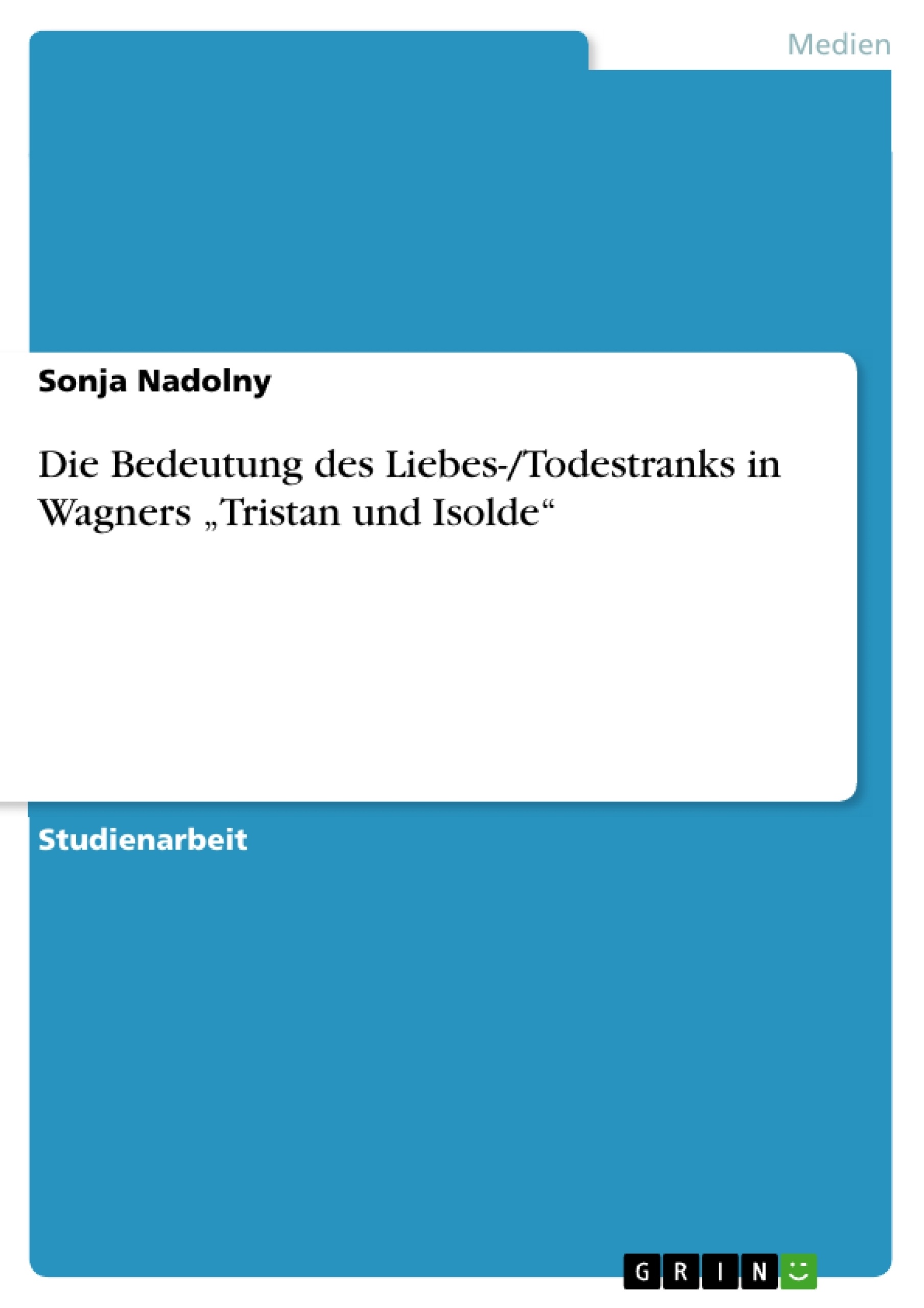Der Liebestrank ist in allen Versionen des Tristanstoffes ein zentrales Motiv. Das gemeinsame Trinken und der anschließende Einbruch der Liebe, die das Verhältnis von Tristan und Isolde sowohl zueinander als auch gegenüber der Gesellschaft radikal verändert, gehört zum festen Repertoire der Tristanliteratur und ist aus der Erzählung nicht wegzudenken. Als Symbol des Verhängnisses, der Unausweichlichkeit des Schicksals liefert der Trank vor allem in den mittelalterlichen Romanen das Alibi für eine Liebe, die rational nicht mehr verständlich ist.
Richard Wagner hat für seine Opernrezeption die Erzählung Gottfrieds als Vorbild verwendet. Auch er bietet dem Trank-Motiv breiten Raum. Das gemeinsame Trinken ist der zentrale Wendepunkt des ersten Aktes und geht dem Liebesgeständnis von Tristan und Isolde unmittelbar voraus. Wiederholt erinnern sich die Liebenden an den Trank als Ursprung ihres emotionalen Wandels und der nachfolgenden Geschehnisse. Andererseits sind die Diskrepanzen zwischen Wagners Oper und seiner mittelalterlichen Vorlage kaum zu übersehen. Anstelle des einfachen Liebestranks, wird der Zuschauer zusätzlich mit einem Todestrank konfrontiert und die Geschichte damit kompliziert. Außerdem enthält die von Isolde berichtete Vorgeschichte Andeutungen, die darauf schließen lassen, dass der Ursprung ihrer Liebe schon vor der Einnahme des Trankes lag.
Es stellt sich deshalb die Frage, welche Funktion Wagner den beiden Tränken zukommen lässt. Ist der Liebestrank immer noch alleiniger Auslöser der Gefühle, wie er uns bei Gottfried begegnet? Oder ist seine Bedeutung weniger zentral? Und wenn Tristan und Isolde sich bereits vor der Einnahme des Trankes lieben, welche Bedeutung kommt ihm dann zu?
Ich werde mich der Beantwortung dieser Fragen auf zweierlei Weise nähern: Einerseits durch die Untersuchung des Librettos und andererseits durch die musikalische Analyse einiger für diesen Zusammenhang bedeutender Stellen der Partitur.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Situation vor dem Trank
2.1 Musikalische Analyse der „Blickszene“
3. Die Trankszene
3.1 Musikalische Analyse der Trankszene
4. Die Wirkung des Liebestranks
4.1 Die Einswerdung der Liebenden
4.1.1 Das Liebesduett
4.2 Liebe und Tod
5. Fazit
6. Literaturliste