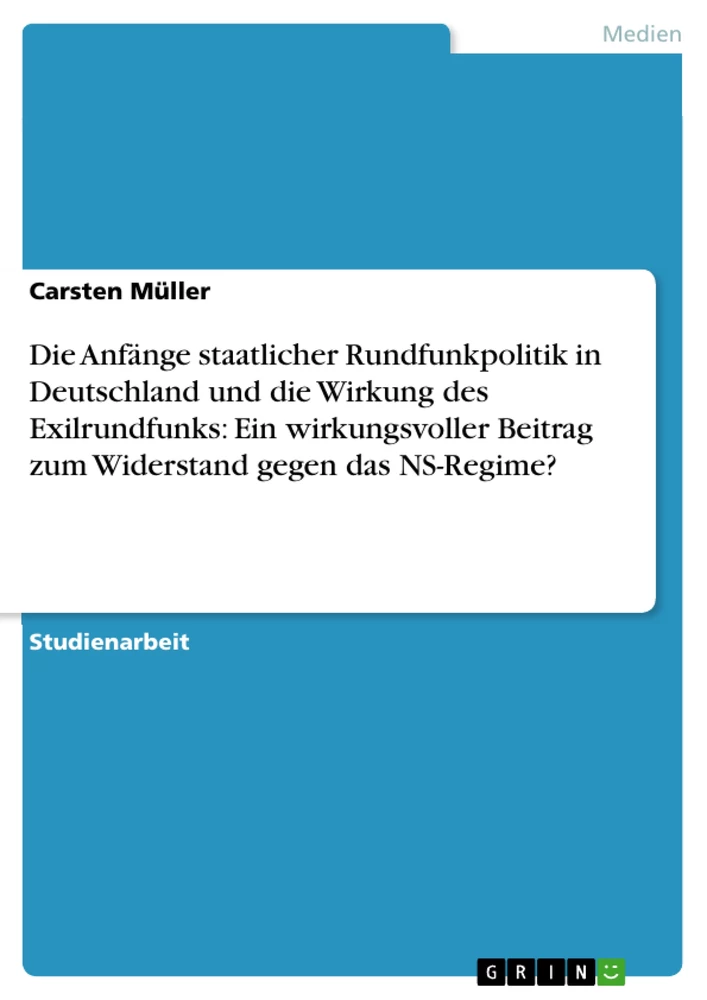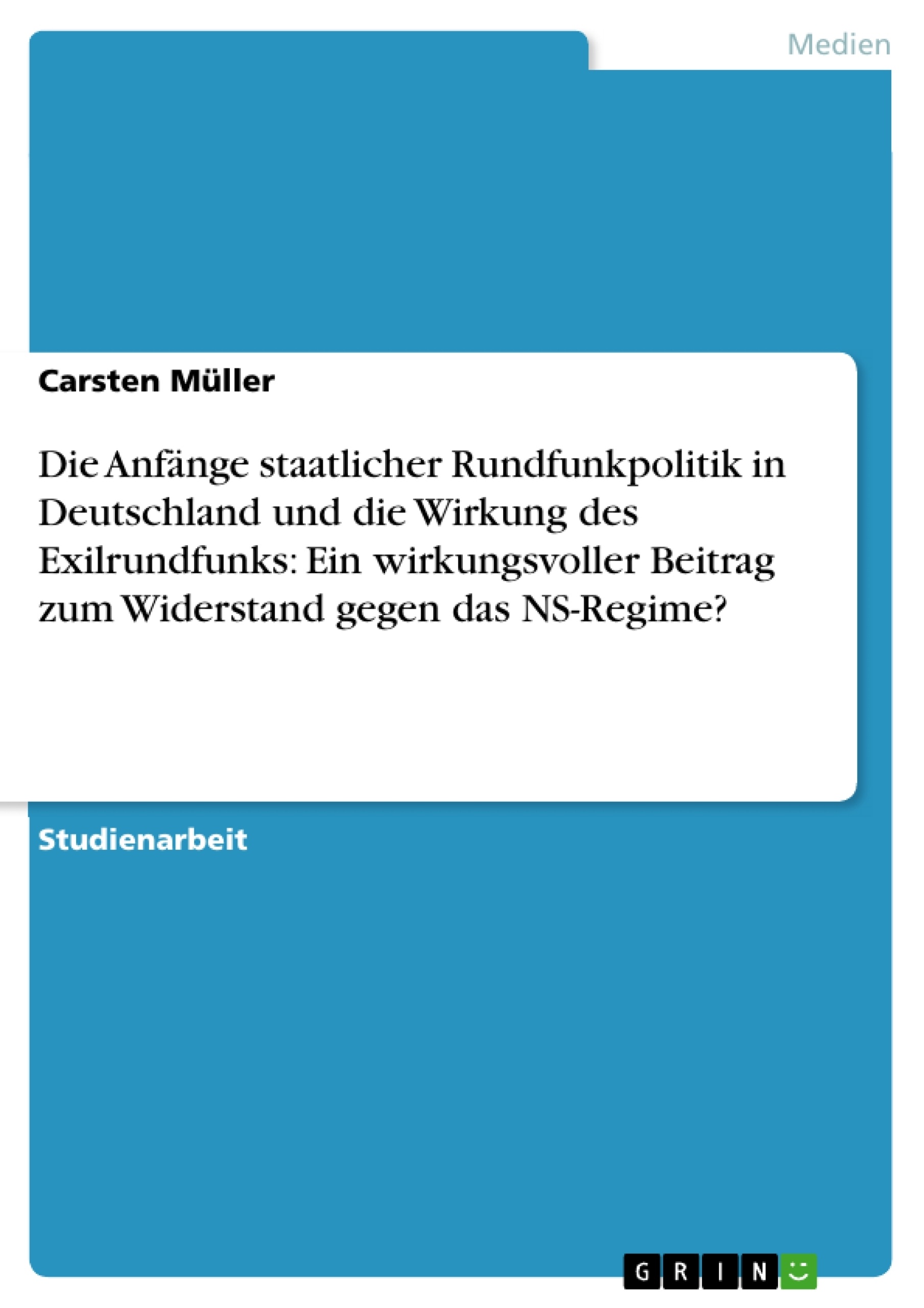Die Beschäftigung mit dem Widerstand im "Dritten Reich" in der historisch-politischen Forschung dient primär dem Ziel, einen Beitrag gegen das Vergessen des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte zu leisten und die Erinnerung an ein unmenschliches Regime aufrecht zu erhalten, damit ähnliche Tendenzen im Ansatz erstickt werden können. Die Erinnerung hat wesentlich zur Stabilität der zweiten deutschen Demokratie beigetragen.
Die vorliegende Arbeit analysiert die Möglichkeiten der deutschen Emigranten, von ihren Auslandsaufenthalten zur Destabilisierung des Regimes beizutragen. Nach einem Überblick über die Anfänge staatlicher Rundfunkpolitik in Deutschland werden die verschiedenen
Möglichkeiten des Exilrundfunks dargestellt. Vor allem der deutschsprachige Dienst der BBC als von den Deutschen während des Nationalsozialismus am meisten gehörter Feindsender und die Ansprachen Thomas Manns, dem Freiheiten wie kaum einem anderen Emigranten eingeräumt wurden, sollen dabei untersucht werden. Anschließend soll die Resonanz und Wirkung des Exilrundfunks erörtert werden, um eine Antwort auf die Frage zu finden, ob die Rundfunknutzung der Emigranten während des Nationalsozialismus ein wirkungsvoller Beitrag zum Widerstand war.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Anfänge staatlicher Rundfunkpolitik in Deutschland
2.1 Das Radio in der Weimarer Republik
2.2 Die Rundfunkpolitik der Nationalsozialisten
3. Widerstand gegen den Nationalsozialismus durch Nutzung des Rundfunks
3.1 Rechtliche und technische Voraussetzungen in den Gastgeberländern
3.2 Die verschiedenen Sendertypen
3.2.1 Die offiziellen Auslandsdienste staatlicher oder militärischer Rundfunkeinrichten
3.2.2 Überzeugungs- oder „Freiheits“- Sender
3.2.3 Tarnsender
3.2.4 Taktische militärische Sender
3.2.5 Binnensender
4. Der Deutsche Dienst der British Broadcasting Corporation (BBC)
4.1 Organisation, Programm und Mitarbeiter der BBC
4.2 Die Radioansprachen Thomas Manns
5. Resonanz und Wirkung der Rundfunksendungen in der Heimat: Ein wirkungsvoller Beitrag zum deutschen Widerstand?
6. Zusammenfassung
7. Literaturverzeichnis