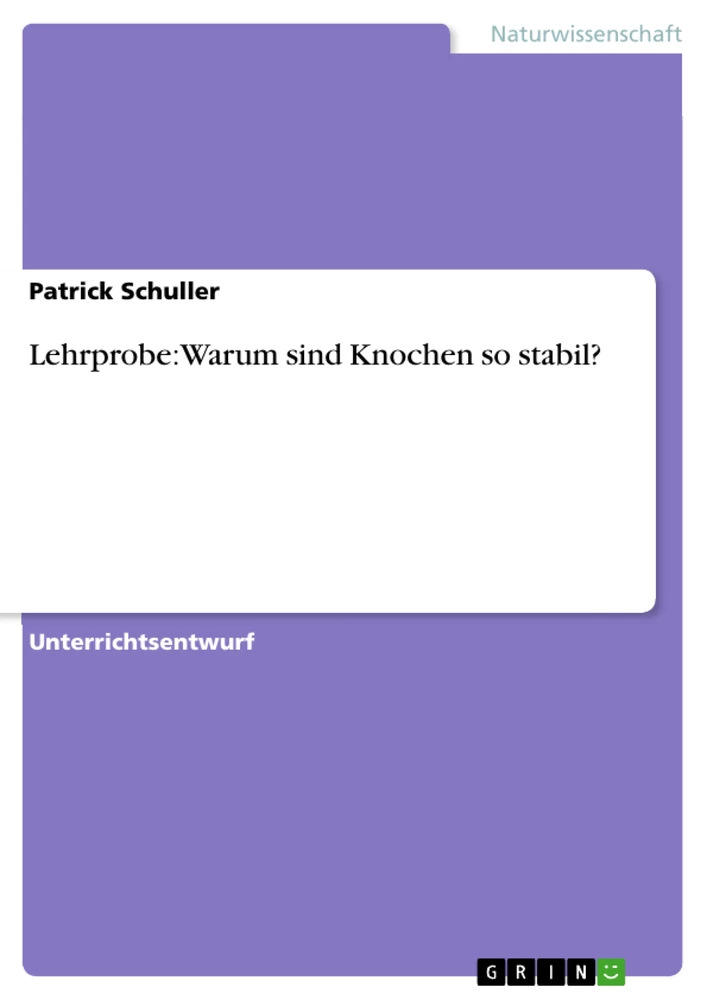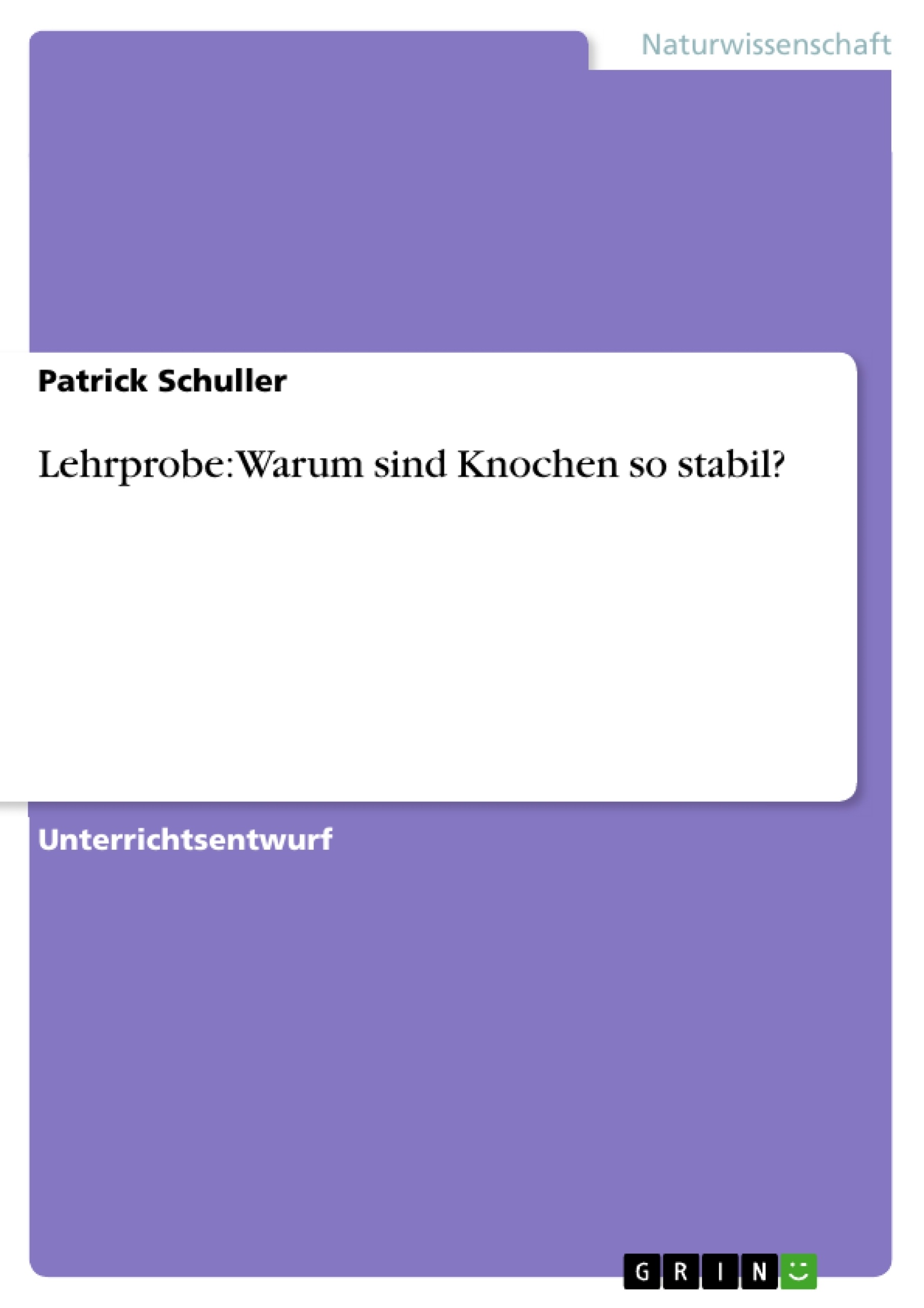Ausführlicher Unterrichtsentwurf zum Thema
Die Struktur von Knochen:
Handlungsorientierte Erfahrungen zu den Konstruktionsprinzipien der Röhrenknochen
Klasse: 5
Fach: Materie, Natur, Technik (MNT)
Inhaltsverzeichnis
1 Bedingungsanalyse 3
1.1 Die Schule 3
1.2 Zur Situation der Klasse 3
1.3 Einzelne Schüler 4
2 Sachanalyse 6
2.1 Das menschliche Skelett 6
2.2 Der Knochen und sein Aufbau 7
3 Didaktische Analyse 8
3.1 Bildungsplanbezug 8
3.2 Bedeutung des Themas für die Schüler 9
3.3 Einbettung der Stunde in die Unterrichtseinheit 10
3.4 Besondere didaktische Anmerkungen 10
3.5 Unterrichtsziele 11
4 Methodische Analyse 12
4.1 Einstieg 12
4.2 Arbeitsphase 12
4.3 Ergebnissicherung 14
5 Verlaufsplanung 15
6 Literatur 16
7 Anhang 17
Inhaltsverzeichnis
1 Bedingungsanalyse
1.1 Die Schule
1.2 Zur Situation der Klasse
1.3 Einzelne Schüler
2 Sachanalyse
2.1 Das menschliche Skelett
2.2 Der Knochen und sein Aufbau
3 Didaktische Analyse
3.1 Bildungsplanbezug
3.2 Bedeutung des Themas für die Schüler
3.3 Einbettung der Stunde in die Unterrichtseinheit
3.4 Besondere didaktische Anmerkungen
3.5 Unterrichtsziele
4 Methodische Analyse
4.1 Einstieg
4.2 Arbeitsphase
4.3 Ergebnissicherung
5 Verlaufsplanung
6 Literatur
7 Anhang.