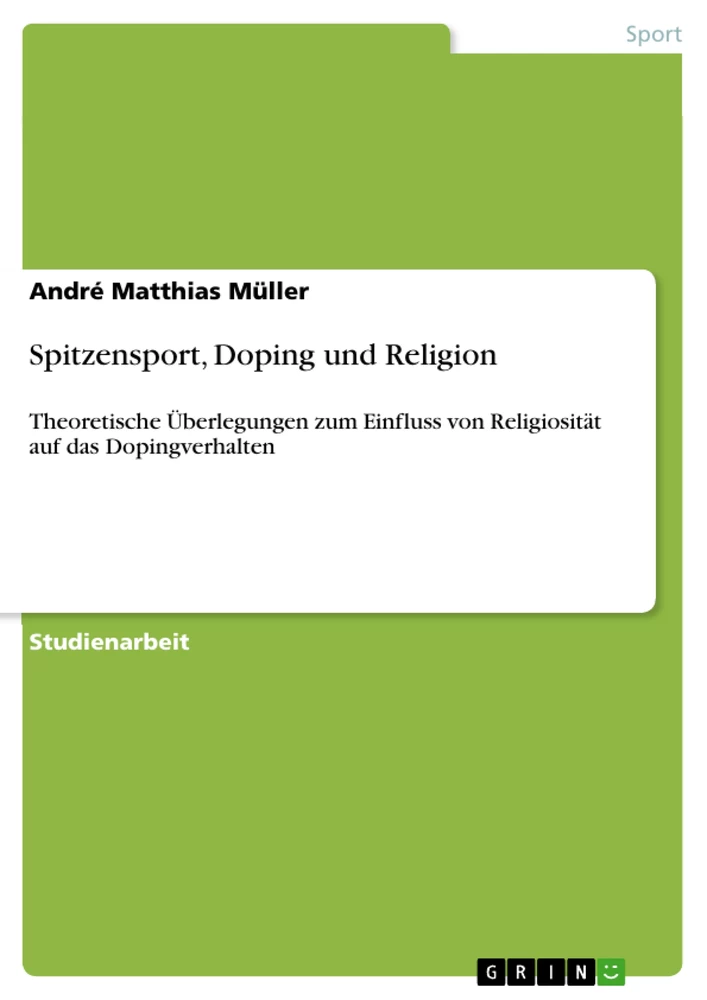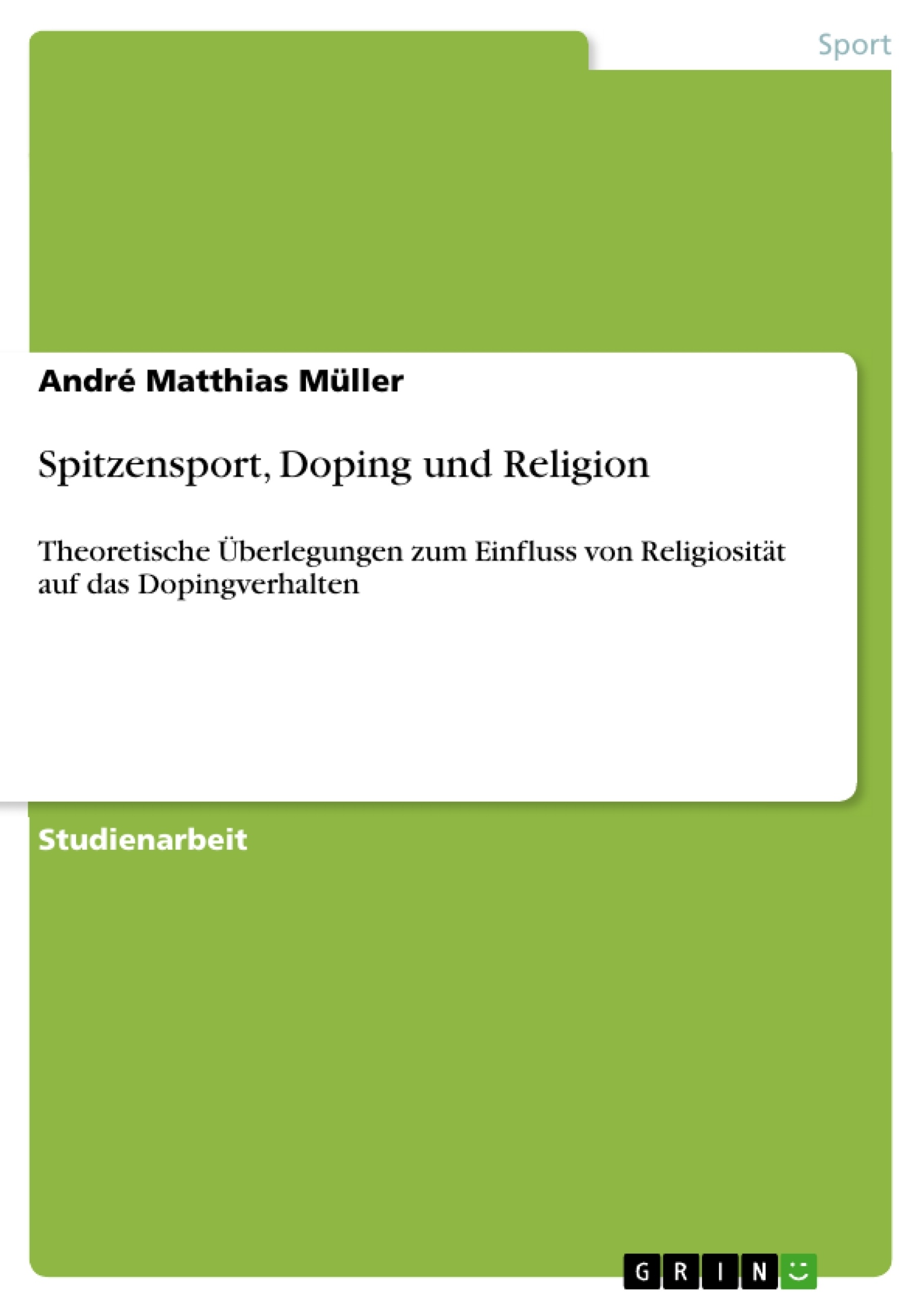Einleitung
Es ist keine Entwicklung der heutigen Leistungsgesellschaft, dass Menschen unentwegt versuchen sich weiterzuentfalten, um aus einer Masse von Individuen hervorzuragen. Jene evolutionsgeschichtliche Notwendigkeit, welche Charles Darwin mit dem Selektionsprozess begründete, ist in der modernen Zivilisation lediglich nicht mehr ein überlebenswichtiges Kriterium. Trotzdessen kann das „Streben nach dem Bessersein […]“ (Figura, 2008, S. 43) als ein zentrales Leitmotiv menschlichen Handelns verstanden werden. Jener Sachverhalt ist, in stark überdimensionierter Form, im Gesellschaftsbereich des Spitzensports beobachtbar. Die sporteigene Binärcodierung in Sieg und Niederlage sorgt in diesem Zusammenhang für die Legitimation jeglichen regelkonformen Interagierens. Laut Bette (2010, S. 90) führt dieser Siegescode zur Exklusion vieler zugunsten weniger, da prinzipiell nur ein Sieg zu vergeben ist. Die immer wieder notwendige Aktualisierung des Gewinnerstatus und der damit verbundenen Erträge, wie Selbstbestätigung, Ansehen und auch Existenzsicherung bringen die Aktiven in nicht wenigen Fällen dazu den gegebenen physischen und psychischen Begrenzungen mit devianten Maßnahmen zu begegnen.
Das Problem des Dopings im Leistungssport ist allen Involvierten wohl bekannt und ließ zahlreiche Möglichkeiten seiner Bekämpfung emporkommen. Die nur sehr partiell erfolgreichen Ansätze reichten dabei von pädagogischen Maßnahmen bis zu Kontrollintensivierungen durch die entsprechenden Institutionen (vgl. Bette & Schimank, 2006, S. 317ff.). Es hat folglich den Anschein, als sei das Dopingdilemma eines mit geringen Chancen hinsichtlich einer adäquaten Lösung.
Religiosität als eine „potent social force“ (McCullough & Willoughby, 2009), die sowohl Verhalten steuert als auch Wege zur Zielerreichung gebietet bzw. verbietet, soll in diesem Hinblick auf ihren Einfluss überprüft werden. Es lassen sich hierzu in der aktuellen Literatur (z.B. Cavar et al., 2010; Francis & Mullen, 1993) Hinweise finden, dass religiöse Anbindung ein Prädiktor für Drogen- und auch Dopingverhalten sein kann. Die Frage der vorliegenden Arbeit soll demnach lauten: Weist das Religionssystem strukturelle Merkmale auf, die bei gläubigen Topathleten eine geringere Tendenz hinsichtlich einer Dopingdevianz zur Folge haben können?
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Der moderne Sport
2.1 Die Vergänglichkeit des Sieges und die Konsequenzen
2.2 Die wechselseitige Dependenz von Sport
und Umwelt
2.3 Die unendliche Anspruchsinflation
3 Doping als Struktureffekt
3.1 Dopingverbot! Warum?
3.2 Lösungsstrategien
4 Das Religionssystem
4.1 Auswirkungen auf das Verhalten
4.1.1 Selbstkontrolle und Selbstmonitoring 12
4.1.2 Religiöse Selbstkontrolle 12
4.2 Religiöse Sozialisation
5 Die Synthese
5.1 Religionscode versus Sportcode und Dopinglogik
5.2 Gesundheit und Fairness
5.3 Religiöse Selbstkontrolle versus sportliche Anspruchsinflation
5.4 Religiöse Sozialisation versus Sozialisation im Spitzensport
6 Zusammenfassung und Ausblick
7 Literatur