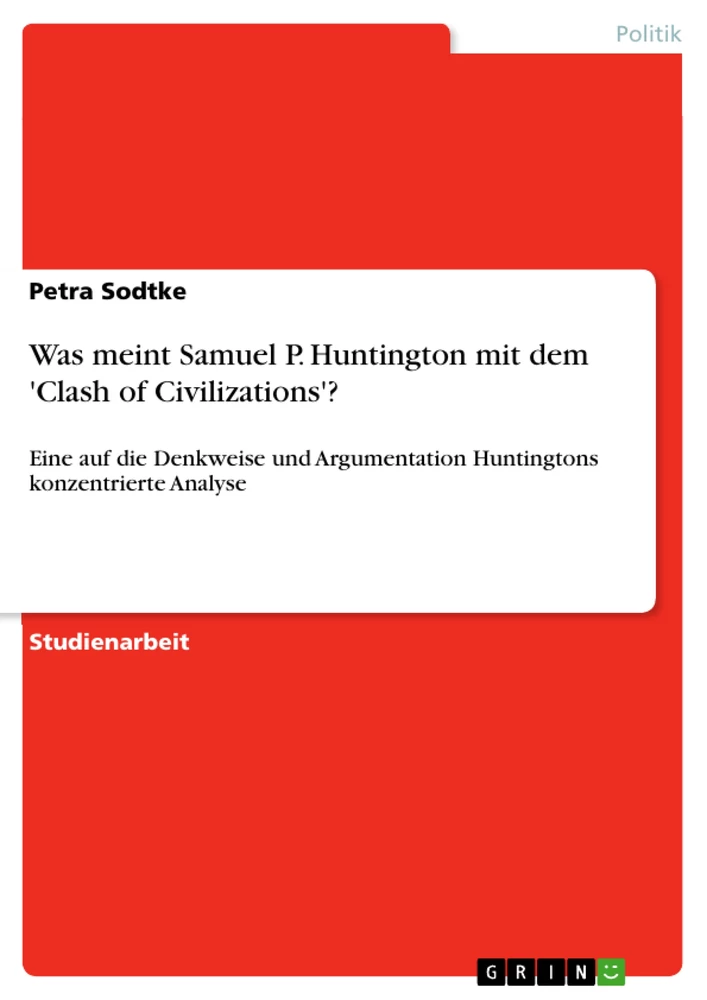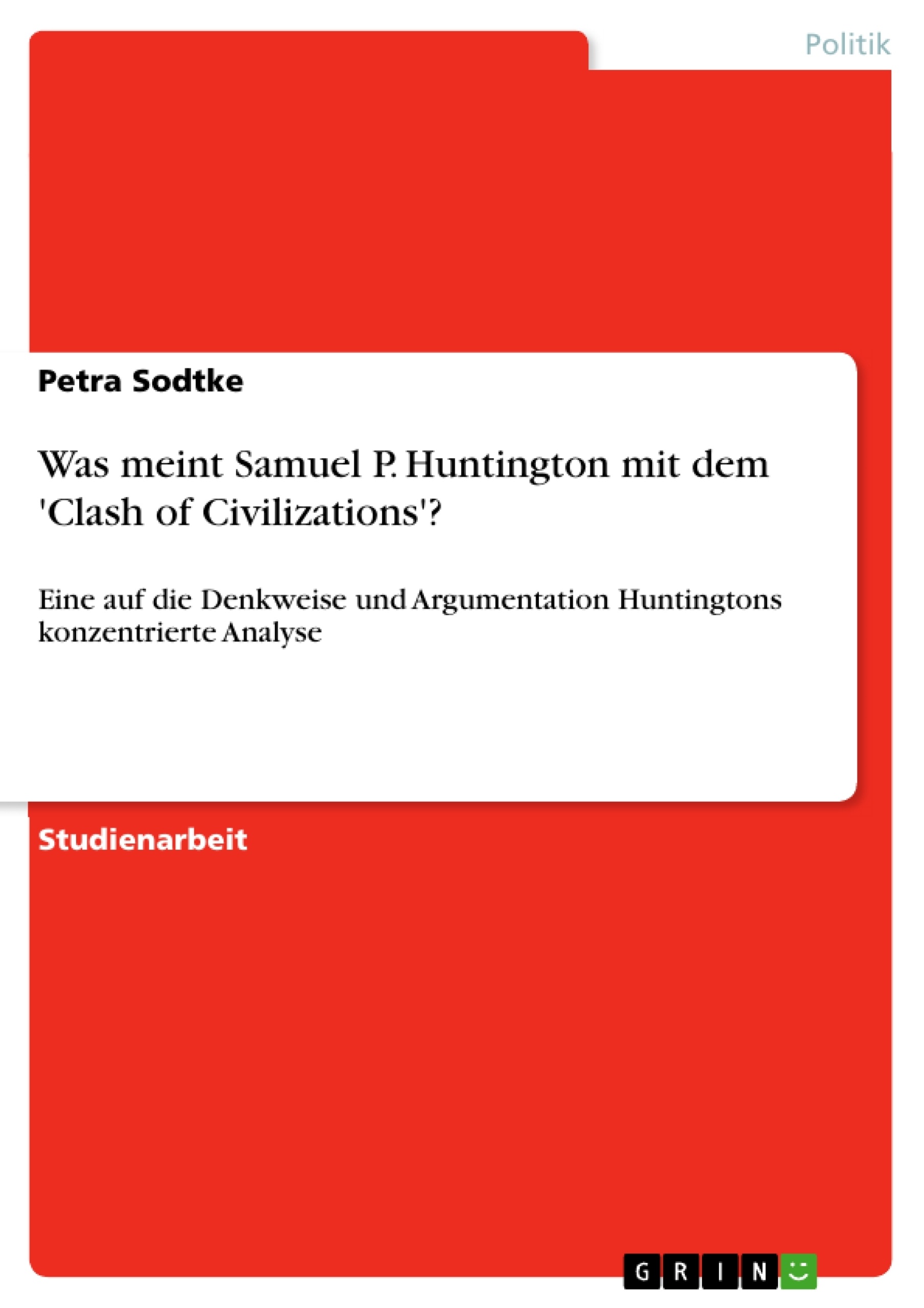Der geopolitisch orientierte Ansatz des US-Amerikaners und Harvard-Lehrenden Samuel P. Huntingtons, bekannt unter dem plakativen Titel ‚Clash of Civilizations‘, hat nach seiner Veröffentlichung in den 1990er Jahren weltweit heftige Reaktionen und Kontroversen ausgelöst und dient auch bei aktuellen Diskussionen zum Themenbereich noch häufig als wichtiges Referenzmodell. Nicht das Ende der Geschichte und des globalen Konflikts, wie Francis Fukuyama prognostiziert hatte, sondern vielmehr das Entstehen neuer Konfliktfelder vor dem Hintergrund einer geänderten, multikulturellen und multipolaren Weltordnung sei anzunehmen, prognostizierte Huntington. Die Weltpolitik werde künftig bestimmt vom Konflikt zwischen sieben oder acht großen Kulturkreisen, die sich je nach Zugehörigkeitsgefühl unterstützend oder feindlich gegenüberstehen würden.
Die Seminararbeit bietet eine kompakte, schlüssige Analyse der Thesen Huntingtons und räumt mit in der medienöffentlichen Diskussion weitverbreiteten Missinterpretationen dieses Ansatzes auf. Sie beantwortet die Forschungsfragen: Was hat Huntington konkret mit seinem Ansatz, mit dem 'Clash of Civilizations', gemeint? Wie lässt sich dieses Modell bzw. Weltbild theoretisch verorten? Vor welchem Hintergrund ist diese Position überhaupt entstanden und welche Aussagen lassen sich (biographisch-kontextuale Elemente berücksichtigend) über Huntingtons Denk- und Argumentationsweise treffen? Welche Strategien bietet Huntington für die Lösung von Konflikten der internationalen Beziehungen und für wie brauchbar sind diese auch im Hinblick auf gegenwärtige Herausforderungen der Weltpolitik einzuschätzen?
Inhalt
1. Vorwort
2. Definitionen
3. Huntington und der „Clash of Civilizations“
3.1. Die Denkweise Huntingtons - kontextuiert mit biographischen Variablen
3.2. „The Clash of Civilizations“: Kurzdarstellung des Inhalts
3.3. Universalismus, universelle Kultur und Multikulturalismus
3.4. Theoretische Verortung
4. Conclusio
Literaturverzeichnis