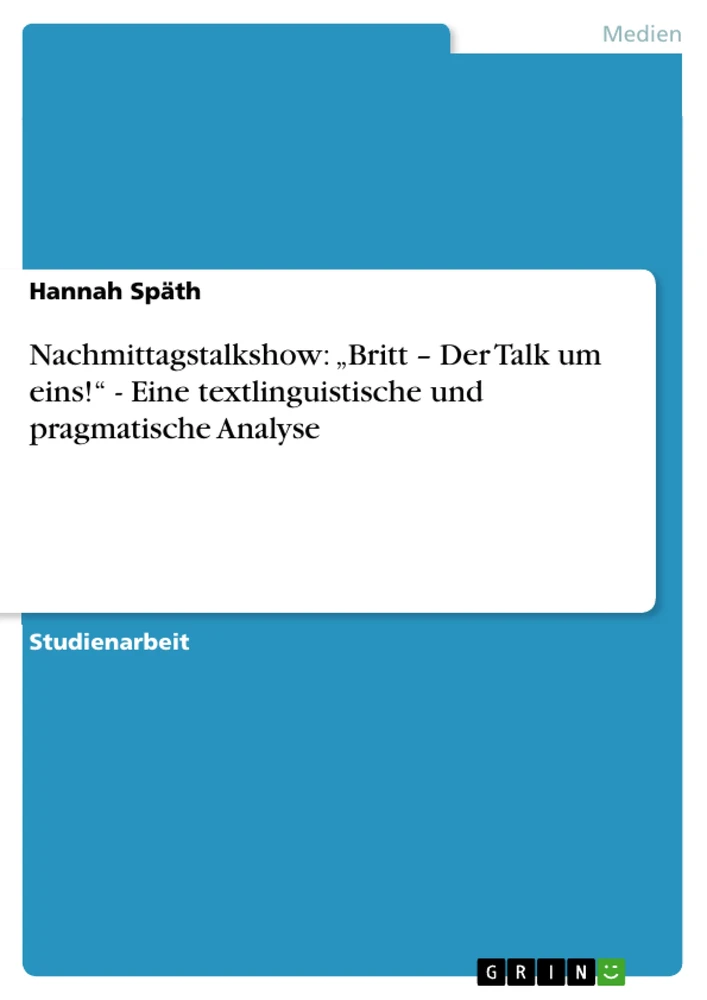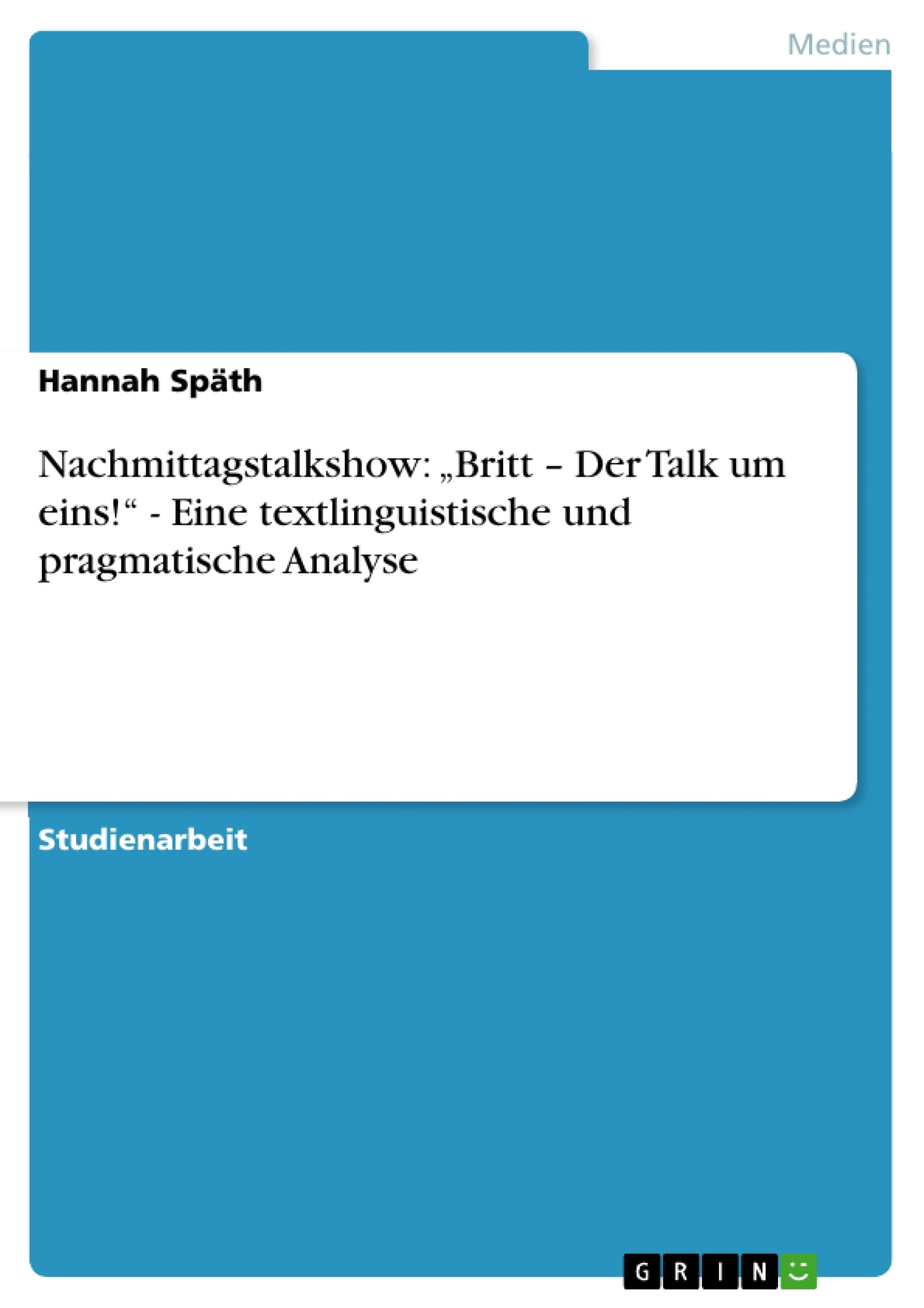„Britt – Der Talk um Eins!“hat keine primär ernsthaften Themen und ist nicht unbedingt auf Problemlösungen ausgerichtet. Im Vordergrund steht die Unterhaltung, trotzdem erhält der Rezipient auch Information und Aufklärung, sodass von Infotainment gesprochen werden kann. „Britt – Der Talk um Eins!“ ist eine Unterhaltungssendung aus einem Fernsehstudio mit Publikum, in deren Mittelpunkt ein lockeres Gespräch zwischen der Gastgeberin Britt und den meist nicht prominenten Gästen steht.
Das Studio, die Moderatorin, die Gäste zu einem bestimmten Thema und das Präsenzpublikum bilden den Frame „Talkshow“. Die verschiedenen Abläufe bei „Britt – Der Talk um Eins!“ sind das Script.2 Im Rahmen der Sendung werden immer abwechselnd Gäste mit gleicher beziehungsweise ungleicher Meinung und Einstellung zum Thema hereingebeten. Sie repräsentieren die beiden Seiten des kontroversen Themas, das durch ein Duplex verdeutlicht wird.
In jeder Sendung gibt es eine Vorschau mit den Highlights der kommenden Sendung, eine Begrüßung und ein Schlusswort durch Britt, ein Gewinnspiel vor und nach der Werbung, Logoeinblendungen und der Sprecher aus dem Off liest Thema der Sendung vor. Diese Stereotypie und Monotonie der Grundkonstellation, die Identität des Moderators, die immer gleichen Abläufe bewirken auf der einen Seite einen Wiedererkennungseffekt, auf der anderen Seite bieten Themen, Gästen, Einlagen, Abläufen, selbst das Outfit die Möglichkeit zur Abwechslung.
Bei „Britt – Der Talk um Eins!“ steht der Vorname des Hosts im Titel. Art, Charakter und Qualität der Show sind direkt abhängig von ihrer Persönlichkeit. Sie hat folglich eine dominante und prägende Rolle. Die Gesprächseröffnung geschieht durch Britt, die das Thema vorstellt und somit eine Basis für die kommenden Gespräche schafft. In der Gesprächsmitte wenden sich die Gäste dem vorher festgelegten Thema zu. Eine Lenkung des Gesprächs erfolgt in der Regel über Fragestellungen von Britt. Auch die Beendigungsphase wird von Britt eröffnet durch eine Zusammenfassung des im Gesprächshauptteil Besprochenen. Anschließend erfolgt eine Danksagung und Verabschiedung der Gäste und Zuschauer.
Vor allem „Soft News“ wie Schicksale, Unglücke, Verbrechen, Liebe, Sex und Religion werden bei Britt diskutiert.3 Es handelt sich dabei um einen Konfro-Talk zu einem Thema, das zwischen Host oder zwischen den Gästen kontrovers diskutiert wird.
Inhalt
1 Einleitung
2 Teaser und Thema der analysierten Talkshow
3 Sprecherwechsel
4 Funktion des nonverbalen Verhaltens
5 Deixis
6 Partikel
7 Mündlichkeit und Schriftlichkeit
8 Sekundäre extradiegetische Inserts
9 Illukutionstypen
10 Allgemeines Kooperationsprinzip
11 Konversationsmaxime
12 Kohäsion
13 Kohärenz
14 Ertragsfunktion
15 Fazit
16 Anhang
17 Literaturverzeichnis