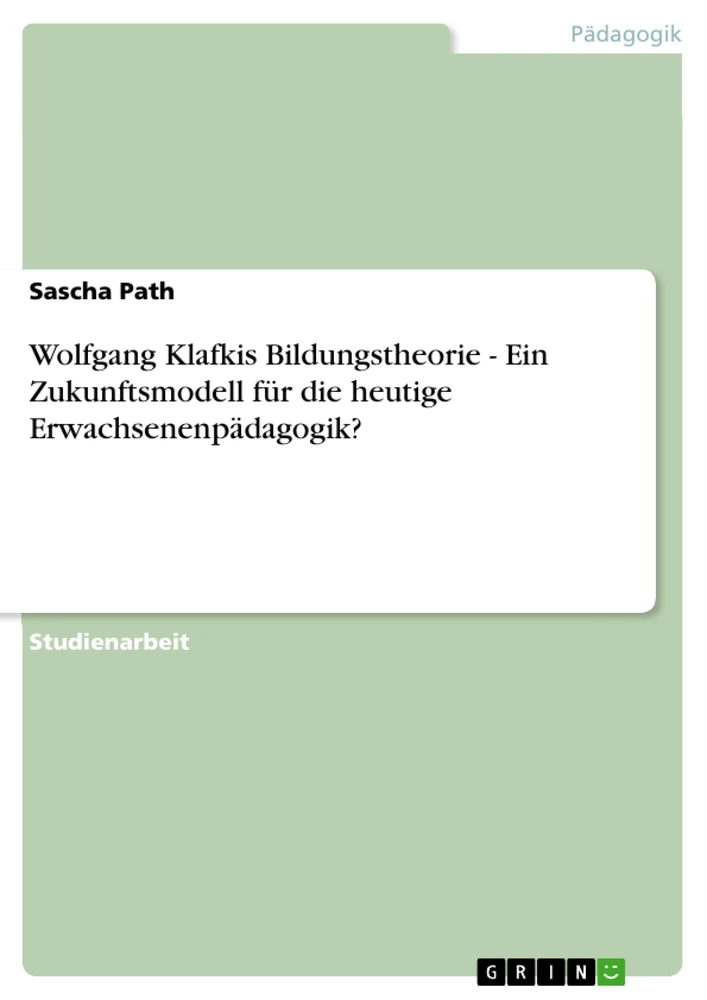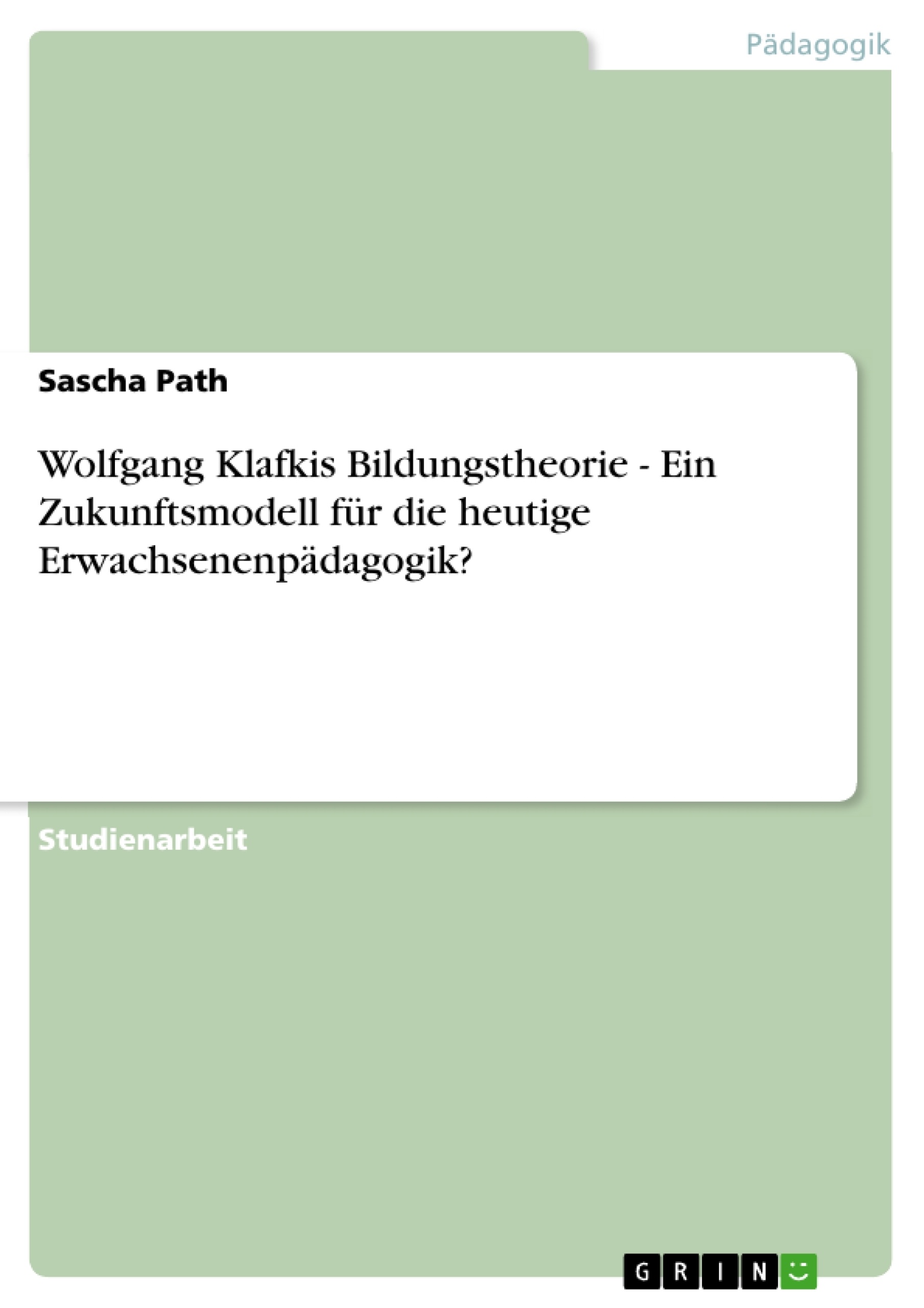Die vorliegende Hausarbeit analysiert und beschreibt die Bildungstheorie Wolfgang Klafkis. Zum Einen soll ein Überblick über Klafkis Bildungsideale gegeben werden. Dies impliziert eine Auseinandersetzung mit den Beweggründen des Autors über die durch ihn erhoffte Verbesserung der Schulbildung und der Didaktik der Lehrerschaft. Zum Anderen soll die historische Betrachtung Klafkis Thesen eine verbesserte Sicht auf Klafkis Definition, was Bildung für ihn bedeutet, darlegen. Eine historische Einordnung von Klafkis Wirken rundet die Gesamtheit der Arbeit ab.
Die zentrale Fragestellung der Ausarbeitung soll die Sichtweise der heutigen Erwachsenenpädagogik in Bezug auf den Bildungsbegriff darlegen. Ist diese noch eine reine Vermittlung von Allgemeinbildung?
Inhalt
1. Einleitung
2. Biographie Wolfgang Klafkis
3. Historische Einordnung
4. Bildung aus der Sicht Klafkis
5. Die neue Didaktik
5.1 Klafki und die Reflexion der Lehrenden
5.2 Veränderte Anforderungen an die Lehrerschaft von Schulen sowie von Weiterbildungsinstitutionen
6. Klafkis Forderungen in Bezug auf die heutige pädagogische Ausrichtung der Erwachsenenbildung
6.1 Bildung/Qualifizierung
7. Fazit/ Ausblick
8. Quellen
8.1 Literaturverzeichnis
8.2 Internetquellen