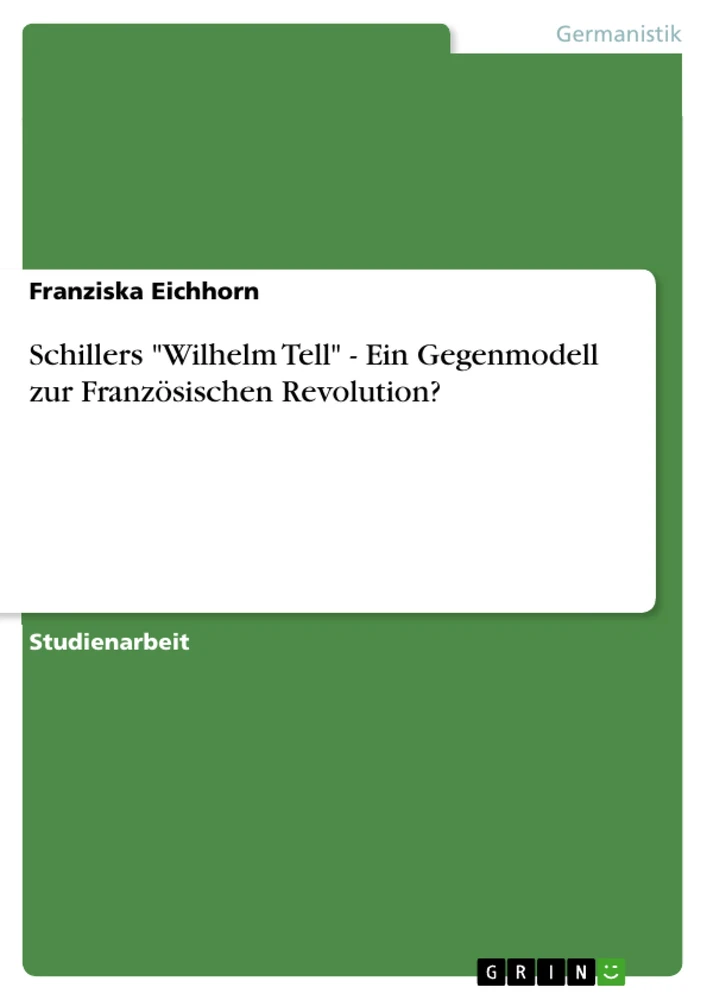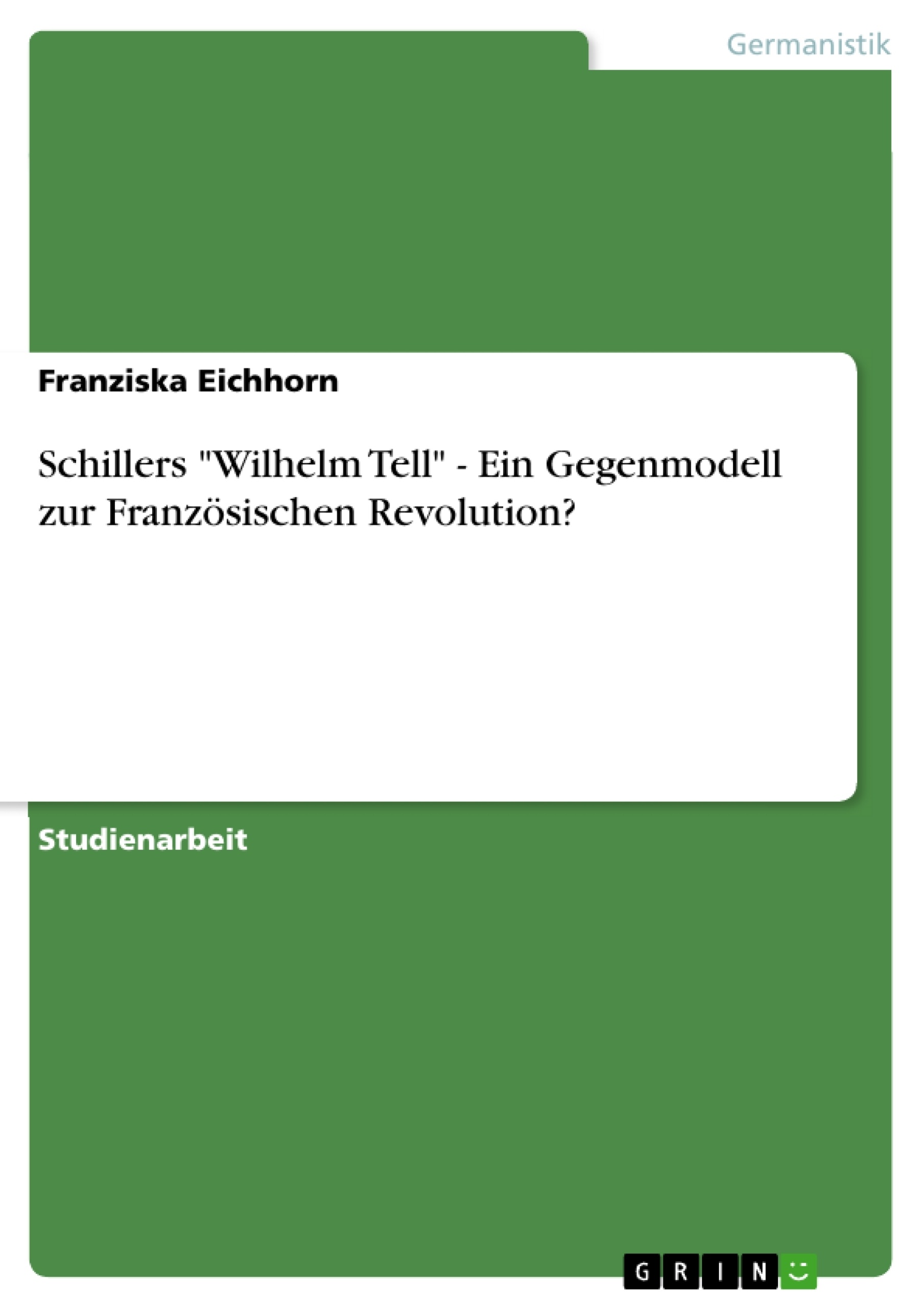Schillers Drama „Wilhelm Tell“, das er 1804 erst nach vielen Unterbrechungen abschließen konnte, stellte das letzte von ihm vollendete Schauspiel dar. Kein anderes Werk der klassischen Periode hat eine ähnliche Nachwirkung erfahren wie Schillers Drama über den Schweizer Nationalhelden. Es diente als ein Vorbild sowohl für die studentischen Patrioten im Krieg gegen die napoleonische Fremdherrschaft als auch für die Demokraten des Vormärzes. Wie im „Wallenstein“ und „Der Jungfrau von Orleans“ wendete sich der Historiker Schiller auch hier wieder einem historischen Thema zu. Mit dem „Wilhelm Tell“ knüpft er unter dem Eindruck der gewaltsamen Ereignisse in Frankreich direkt an die zeitgenössischen Diskurse an, ob und unter welchen Umständen revolutionäres Handeln als gerechtfertigt angesehen werden kann.
Im Mittelpunkt meiner Arbeit soll die Frage stehen, inwieweit sich Bezüge zwischen Schillers Drama und der Französischen Revolution herstellen lassen und wo Unterschiede auftreten. Dabei möchte ich auch darauf eingehen, bis zu welchem Grad die anderen revolutionären Ereignisse wie zum Beispiel in den Niederlanden und speziell in der Schweiz im „Tell“ verarbeitet wurden. Im Vordergrund soll dabei stehen, wie Schiller zur damals aktuellen und von den revolutionären Ereignissen untrennbaren Diskussion über das Widerstandsrecht Stellung genommen hat. Weiterhin möchte ich auf die Position Schillers gegenüber Revolutionen und die Verarbeitung zeitgenössischer theoretischer Auseinandersetzungen eingehen.
Ich schildere zunächst die Entstehung des Dramas und dessen zeitgenössische Bezüge. In einer Analyse der Rütli-Szene möchte ich darstellen, wie Schiller in dieser konkreten Szene Bezüge zur Französischen Revolution und der Debatte um das Widerstandsrecht hergestellt hat. Im nächsten Schritt möchte ich auf die Problematik des Tyrannenmordes eingehen, welche gerade vor dem Hintergrund der Hinrichtung Ludwig XVI. während der Französischen Revolution aktuell war. Abschließend soll erläutert werden, wie sich Schiller selbst in seinen theoretischen Schriften mit den revolutionären Ereignissen Ende des 18. Jahrhunderts auseinandergesetzt und Bezug auf andere theoretische Schriften seiner Zeit genommen hat.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Entstehung des Dramas und die zeitgenössischen Bezüge
3. Die Rütliszene
3.1 Die Formierung des Widerstands
3.2 Der Gründungsmythos
3.3 Ein Plädoyer für den aktiven Protest
3.4 Die Ziele der Verschwörung
3.5 Die Folgen des Bundes
4. Das Problem des Tyrannenmords und dessen Bezüge zur Französischen Revolution
5. „Wilhelm Tell“ - Schillers Antwort auf die Französische Revolution?
5.1 Verarbeitung der revolutionären Ereignisse im Drama
5.2 Schillers theoretische Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution
5.3 Bezüge des „Tell“ zu zeitgenössischen theoretischen Schriften
5.4 Schillers „Tell“ als Gegenmodell zur Französischen Revolution?
6. Schlusswort