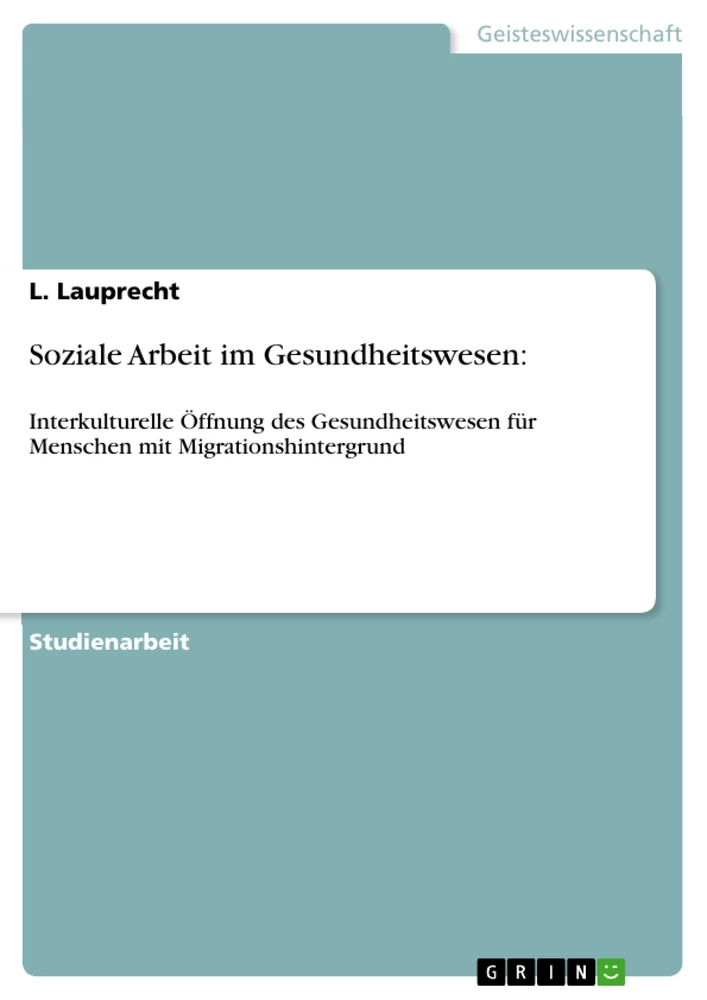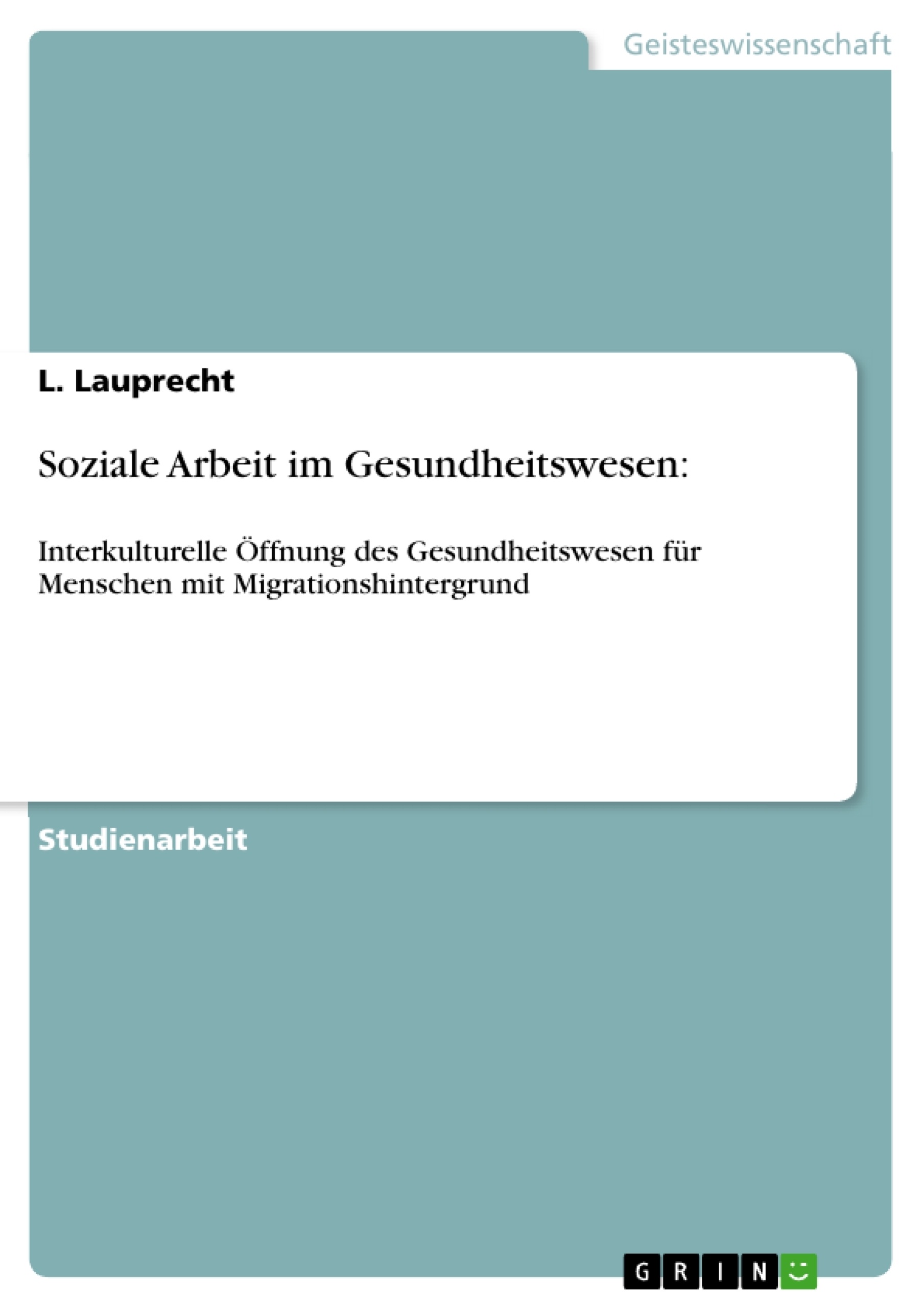Die Forderung nach „Interkultureller Öffnung“ des Gesundheitswesens für Menschen mit Migrationshintergrund impliziert ja bereits, dass der Zugang zu einer effektiven Gesundheitsversorgung entsprechend der Bedarfslage dieser Zielgruppe gewissermaßen verschlossen ist, bzw. dass es Zugangsbarrieren gibt, die es zu überwinden gilt. (vgl. Statistisches Bundesamt 2008, S.107, vgl. Razum/Geiger, 2003, S.689) Es bedeutet gesellschaftlicher Einrichtungen zu öffnen und zu qualifizieren „mit dem Ziel, Migrantinnen und Migranten einen gleichwertigen Zugang zu ermöglichen“ (Beauftragte der Bundesregierung für Migranten, Flüchtlinge und Integration 2003, S.138).
Inhaltsverzeichnis:
1 WAS IST UNTER DER INTERKULTURELLEN ÖFFNUNG VON PRÄVENTIVER BERATUNG UND KURATIVER VERSORGUNG FÜR MENSCHEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND ZU VERSTEHEN?
1.1 KOMMUNIKATIONSPROBLEME UND INFORMATIONSDEFIZITE
1.2 UNTERSCHIEDLICHES VERSTÄNDNIS VON GESUNDHEIT/KRANKHEIT
1.3 MIGRATIONSSTATUS/MIGRATIONSERFAHRUNGEN
2 WAS SIND HIER FÖRDERNDE, WAS BEHINDERNDE MOMENTE?
2.1 RESSOURCEN VON MIGRANTINNEN ALS FÖRDERNDE MOMENTE INTERKULTURELLER ÖFFNUNG
2.2 HINDERNISSE
3 WER SIND IHREM ERACHTEN NACH DIE DERZEIT WICHTIGSTEN ZIELGRUPPEN?
3.1 PERSONEN OHNE RECHTLICH GESICHERTEN AUFENTHALTSSTATUS
3.2 FRAUEN
3.3 KINDER UND JUGENDLICHE
3.4 ÄLTERE PERSONEN
4 WELCHE STRUKTUREN UND EINRICHTUNGEN WÄREN WIE BETROFFEN?
5 WO HINGEGEN BLEIBT DIE FORMEL REIN PLAKATIV?
6 SKIZZIEREN SIE ZUM ABSCHLUSS EIN AUS IHRER SICHT „GUTES BEISPIEL“ AUS DER BERUFLICHEN PRAXIS!
7 LITERATURVERZEICHNIS