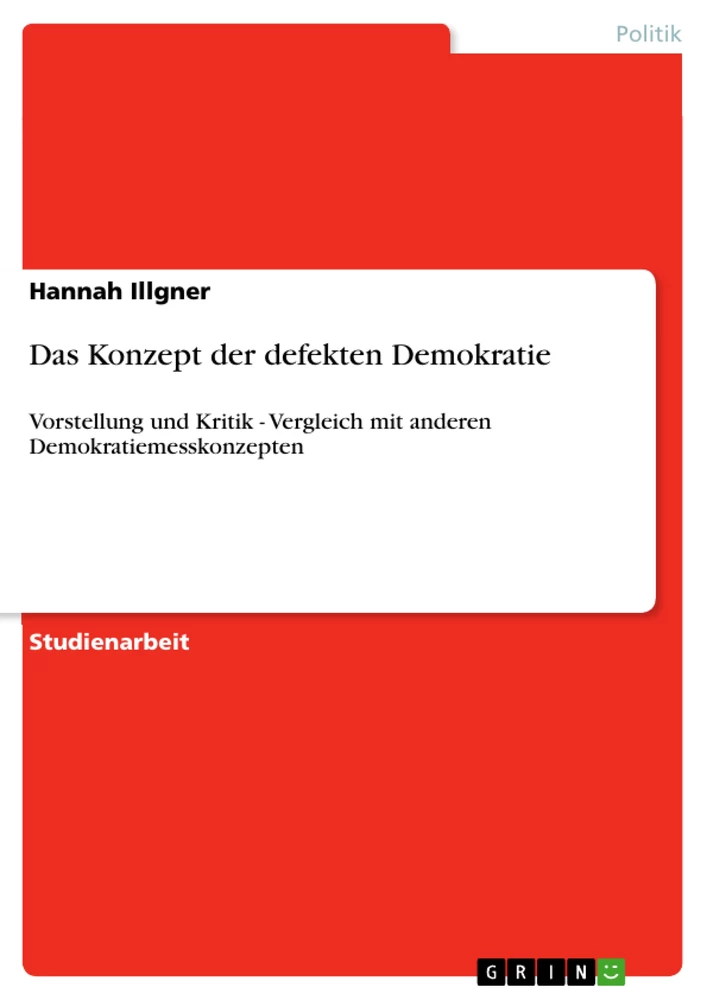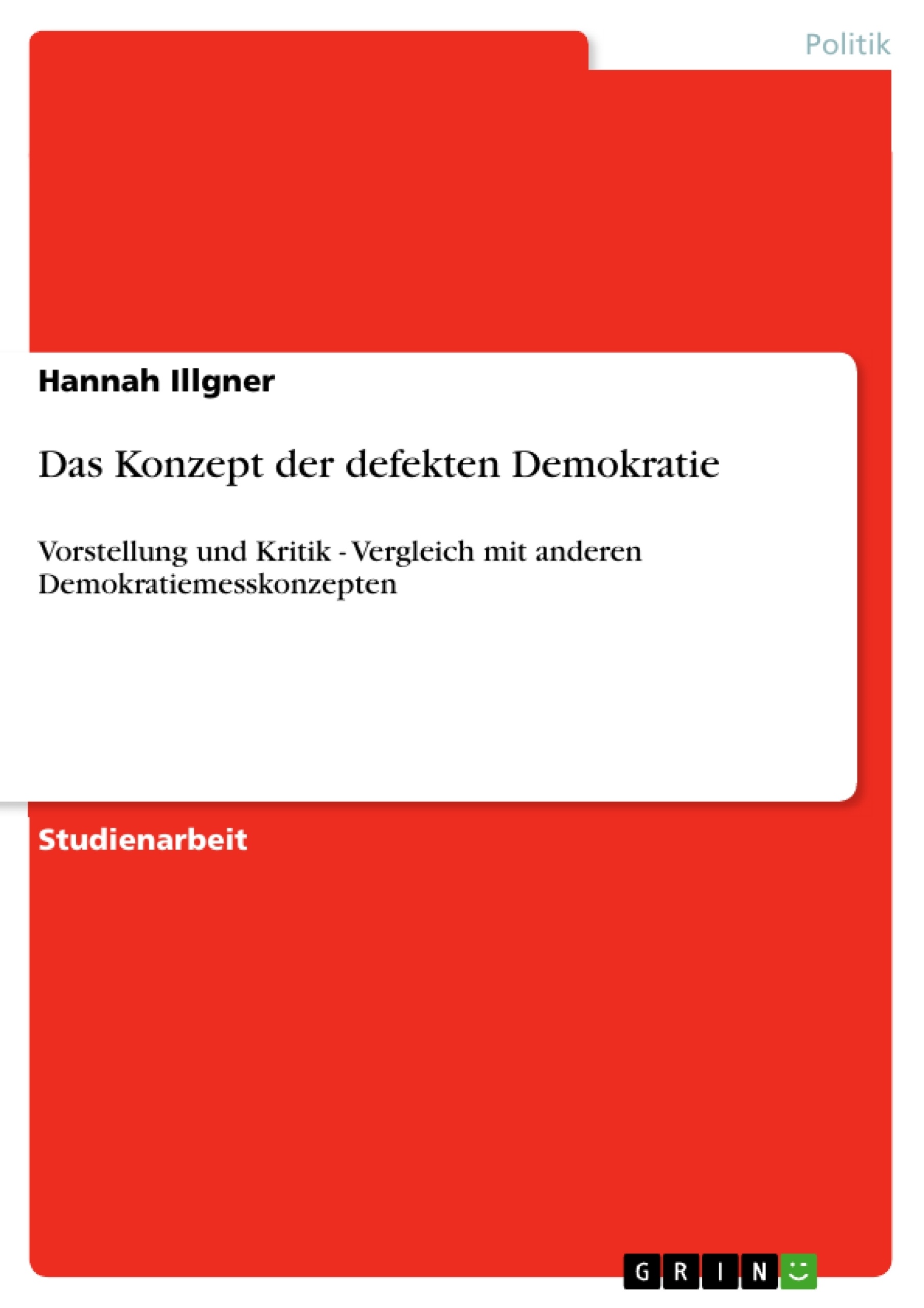Im Vordergrund dieser Arbeit soll die Vorstellung des Konzepts der defekten Demokratie stehen, deshalb nimmt dessen Vorstellung großen Raum ein, um so eine spätere Kritik fundiert nachvollziehen zu können. Der Vergleich mit anderen Demokratiemesskonzepten wird gemacht, um die unterschiedlichen Ansätze der Messungen auf zu zeigen.
Das Konzept der defekten Demokratie wurde entwickelt, um Regime klassifizieren zu können, die sich in einer Grauzone zwischen Demokratie und Autokratie befinden. Diese so genannten hybriden politischen Regime konnten in der Transformationsforschung, vor allem bezüglich deren Typisierung, selten eindeutig und noch weniger einstimmig, eingeordnet werden. Das von Merkel, Puhle, Croissant, Eicher und Thiery entwickelte Konzept versucht dieses Problem zu lösen und bietet die Möglichkeit solche Grauzonenregime einordnen und typologisieren zu können.
Hierbei gehen sie von der Methodik der „diminished subtypes“ von Collier und Levitsky aus. Die defekte Demokratie wird als „unvollständiger“ Subtyp definiert. Um dies zu präzisieren, werden defekte Demokratien in vier weitere Subtypen unterschieden (vgl. Merkel et al. 2003: S.291).
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Terminologie
Diminished subtypes
Hybride Regime
Autokratien
Polyarchie
Liberal (-rechtsstaatliche) Demokratie
3. Demokratiekonzept
4. Konzept der embedded democracy
5. Das Konzept der defekte Demokratie
6. Typologie defekter Demokratien
6.1 Exklusive Demokratie
6.2 Illiberale Demokratie
6.3 Delegative Demokratie
6.4 Enklavendemokratie
7. Messung defekter Demokratien
8. Kritik am Konzept der defekten Demokratie
9. Vergleich mit anderen Messkonzepten
Freedom-House-Index
Bertelsmann-Transformation-Index
Fazit
10. Schlusswort
11. Literaturverzeichnis