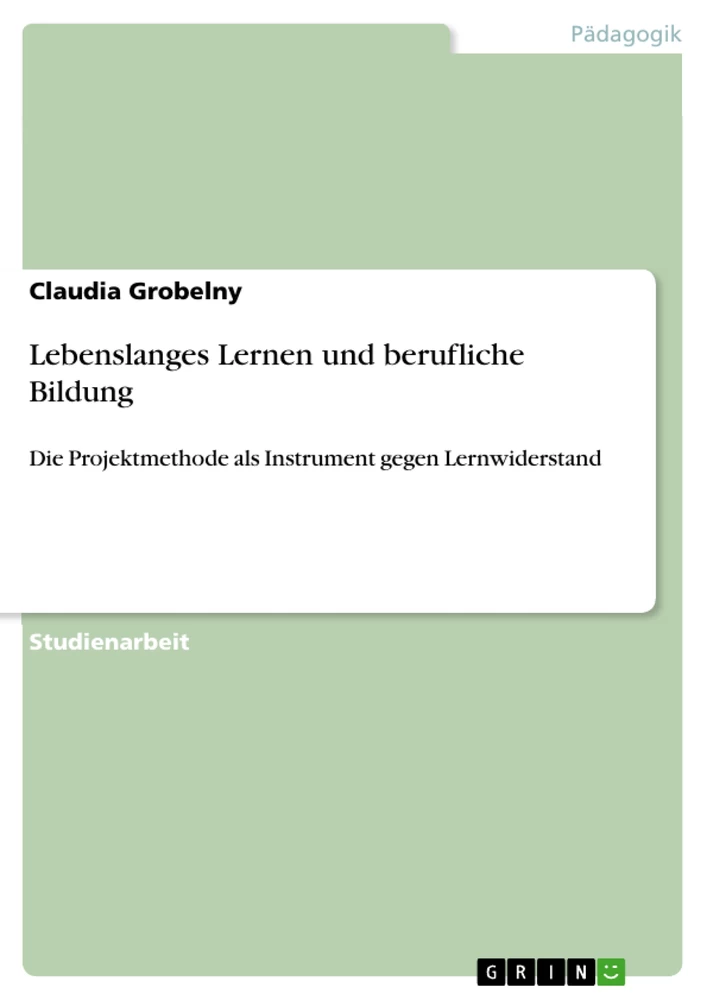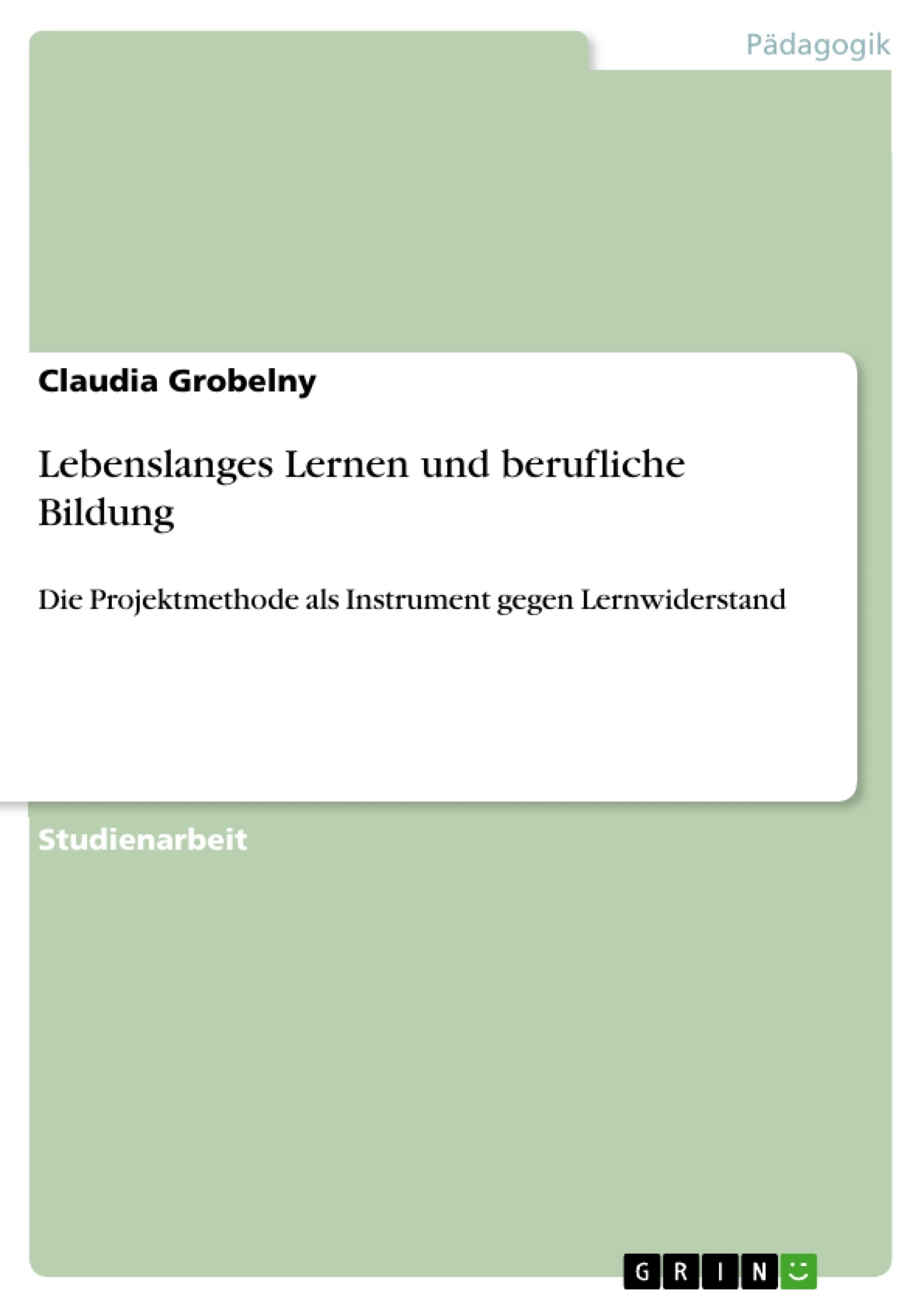In der Literatur der neueren Zeit wird im Hinblick auf den Begriff der Wissensgesellschaft oftmals die Problematik aufgeworfen, dass gerade Deutschland, auf Grund von geringen natürlichen Ressourcen, auf seine qualifizierten Facharbeiter angewiesen ist. Globalisierung, erhöhter Konkurrenzdruck und sich verändernde Arbeitsorganisationen, Arbeitsinhalte und -prozesse verlangen flexible Mitarbeiter, die vermehrt komplexere Aufgaben und mehr Verantwortung übernehmen sollen; die eine hohe Problemlösefähigkeit besitzen, sich stets weiterbilden und neue Kompetenzen und Fähigkeiten erwerben. Die Forderung nach lebenslangem Lernen zeichnet sich demnach auch in der Erwerbstätigkeit ab. Die Anforderungen, die die Organisation an seine Mitglieder stellt, ist allerdings ein Ideal, welches u.a. mit Hindernissen und Hemmnissen seitens der Stelleninhaber verbunden ist. Ein Aspekt, mit dem sich die Personalentwicklung befassen muss, ist der Lernwiderstand der Organisationsangehörigen. In diesem Zusammenhang ist die Frage interessant, wie die Organisation Möglichkeiten schaffen kann, das Ziel der Wettbewerbsfähigkeit ökonomisch zu realisieren und dabei die Kluft zwischen der Förderung eigenständiger Weiterbildung der Mitarbeiter einerseits und deren Widerstand gegen das Lernen andererseits zu überwinden. Das Thema der Hausarbeit befasst sich mit dem Themenfeld „Lebenslanges Lernen und berufliche Bildung“. Im Zentrum dieses Themas steht das Lernen in der Organisation, abseits vom Einzelarbeitsplatz, aber innerhalb einer partizipativen Arbeitsform; in dieser Arbeit exemplarisch die Projektarbeit. Im Speziellen soll die Frage diskutiert werden, ob sich die Projektmethode als Instrument gegen Lernwiderstände eignet. Zentrale Blickpunkte sollen sein, wie Erwachsene lernen, welche Faktoren ihre Einstellung zum Lernen beeinflussen, was diese Haltungen prägt und welche Voraussetzungen für das Erreichen des Lernziels gegeben sein müssen. Konkret soll der Frage nachgegangen werden, ob die Projektmethode als Lernarrangement die Voraussetzungen bietet, die der Erwachsene benötigt, um sich einen Lerngegenstand anzueignen. Hierzu soll aufgezeigt werden, aus welchen Gründen und unter welchen Bedingungen Erwachsene lernen und welche Umstände Lernwiderstände begünstigen. Danach soll der Aufbau der Projektmethode dargestellt werden. Abschließend soll eine kritische Betrachtung erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Zur Bedeutung des Lernens am Arbeitsplatz
2. Lernen aus subjektiver Sicht und die subjektwissenschaftliche Lerntheorie (SLT)
3. Lernen und Lernwiderstände im Erwachsenenalter
3.1 Die Rolle von Deutungsmustern innerhalb der Personalentwicklung
3.2 Gründe für Lernwiderstand in Bezug auf die Lernbiografie und den sozialen Kontext
3.3 Die Bedeutung sozialer Milieus für die Weiterbildung.
3.4 Merkmale des erwachsenen Lernens und Gestaltung der Lernsituation
4. Die Projektmethode und ihre Bedeutung für das Lernen
5. Fazit
Tabellenverzeichnis
Literaturverz eichnis