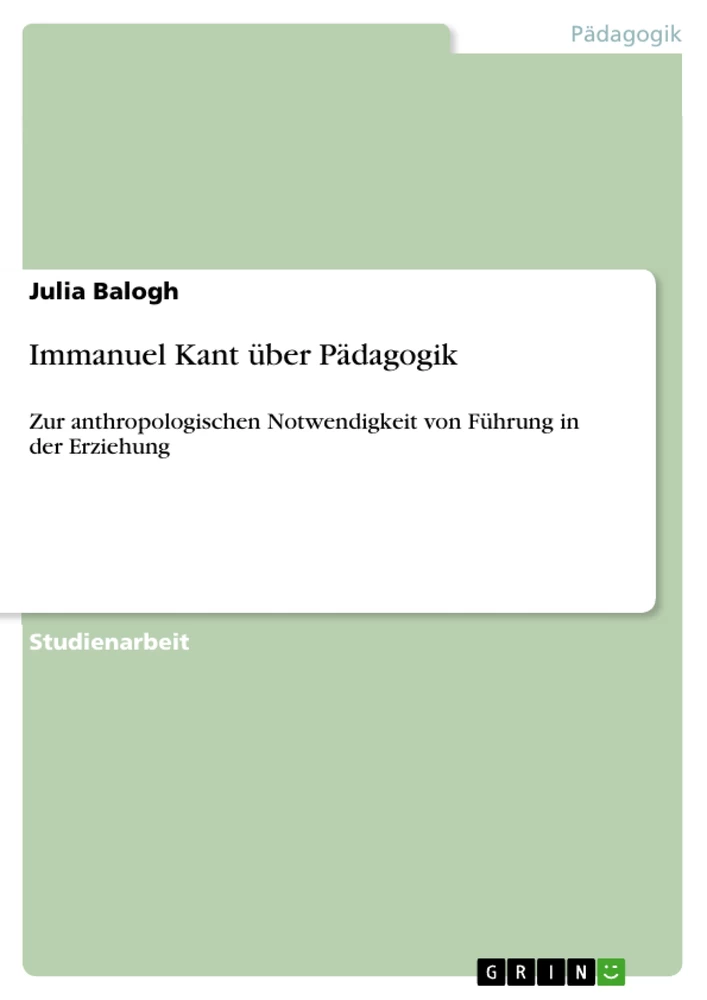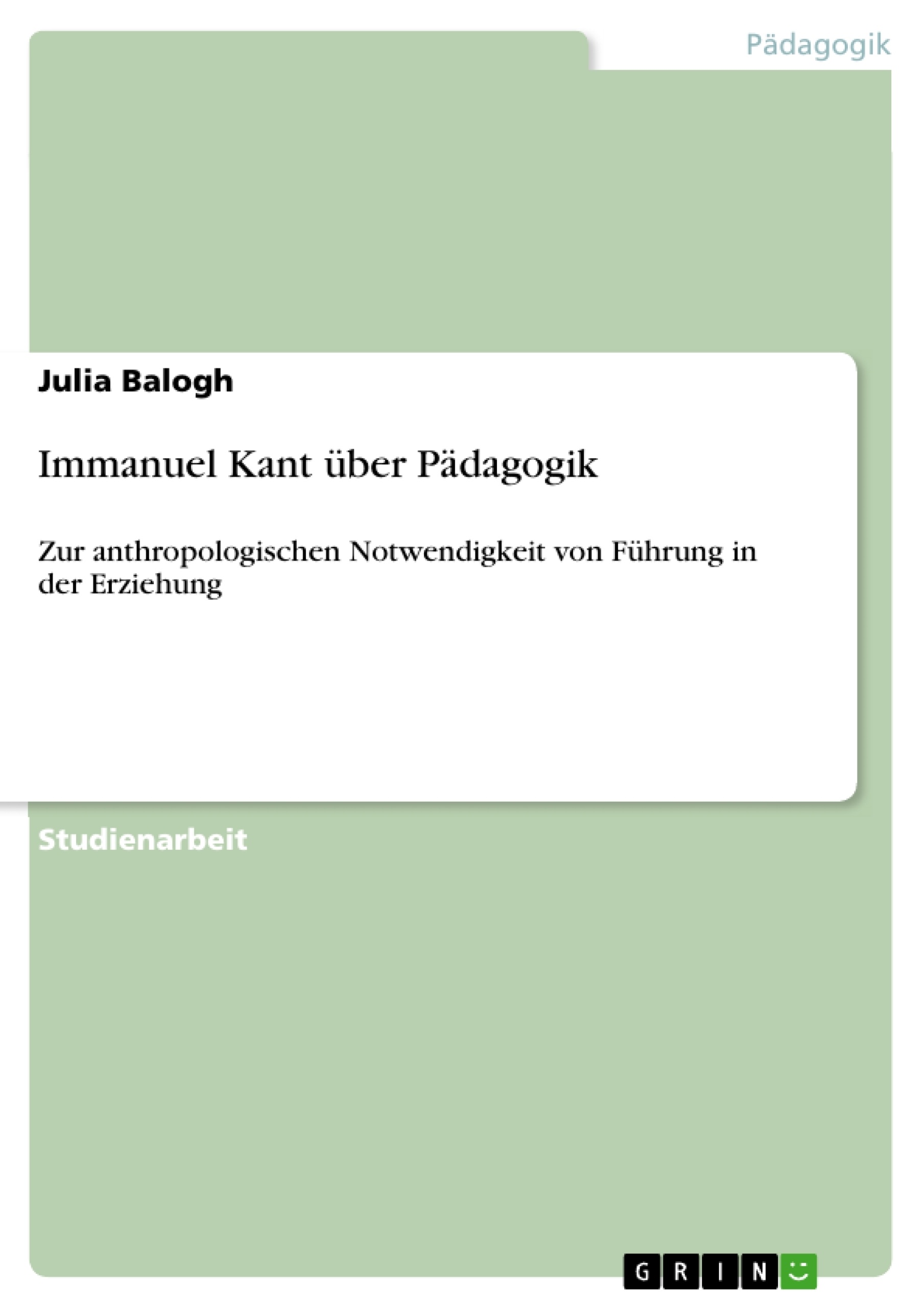Schaut man sich ein wenig in der Welt um, erscheint die Erziehung des Menschen als eines der primären Lebensziele. Zuerst erfolgt sie durch andere Menschen. Schon kleinen Kindern werden durch ihre Eltern Regeln aufgegeben, im Kindergarten und vor allem durch die Schulpflicht wird sie zum festen Bestandteil des Lebens eines jeden Individuums in entwickelten Ländern. Später, wohlmöglich nach einem Studium im Rahmen dessen die Erziehung zur Selbsterziehung wird, folgen Fortbildungen – vorgeschrieben oder freiwillig. Folgt der Mensch mit diesem steten Bildungsbestreben einem inneren Drang zur Weiterbildung und somit Erziehung, der schlichtweg seiner Natur entspringt, oder handelt es sich wohlmöglich um die Verinnerlichung eines von außen auferlegten Zwanges.
Schon Immanuel Kant beschäftigte sich im Rahmen seiner Vorlesung über Pädagogik mit dieser Thematik und statuiert eine sich aus der Vernunftbegabtheit des Menschen ergebende, natürliche Notwendigkeit von Erziehung des Menschen. Da jener jedoch zunächst nicht von Beginn seines Lebens dazu imstande ist, sich zu erziehen und zu bilden, bedarf er der Unterweisung von außen, der Edukation durch bereits erzogene Artgenossen.
Diese Arbeit beschäftigt sich damit, diese kantschen Gedanken in dem und von Theodor Rink überlieferten, bezüglich Stringenz und Aufbau nicht unproblematischen Dokument „Über Pädagogik“ aufzudecken und im Sinne Kants nachvollziehbarer zu machen. Sie beschäftigt sich also vor allem mit der Darstellung der Notwendigkeit von Führung in der Erziehung. Eine Bewertung und Kritik der kantschen Thesen erweist sich als äußerst schwierig, handelt es sich bei seinen Überlegungen im Grunde um die Frage nach dem Ursprung aller menschlichen Existenz sowie um die Annahme des Menschen als höchstem Wesen auf Erden. Ihre Ergründung überlasse ich weiterhin den Philosophen.
Ich beginne meine Ausführung mit der Thematisierung der Notwendigkeit von Erziehung (2.1), die einer Notwendigkeit von Führung in derselben (2.2) vorausgeht. Letztere besteht aus verschiedenen Phasen, in welchen ich den ihnen nach Kant entsprechenden Bedarf einer Führungskraft zur Bildung des Menschen nachzuzeichnen versuchen werde.
Inhalt
1. Einleitung
2. Zur Annahme der anthropologischen Notwendigkeit von Führung in der Erziehung in Immanuel Kants Vorlesung‚Über Pädagogik’
2.1 Zur anthropologischen Notwendigkeit von Erziehung
2.2 Zur anthropologischen Notwendigkeit von Führung in der Erziehung
2.2.1 Disziplin
2.2.2 Kultur
2.2.3 Moralisierung
3. Fazit
4. Literaturverzeichnis