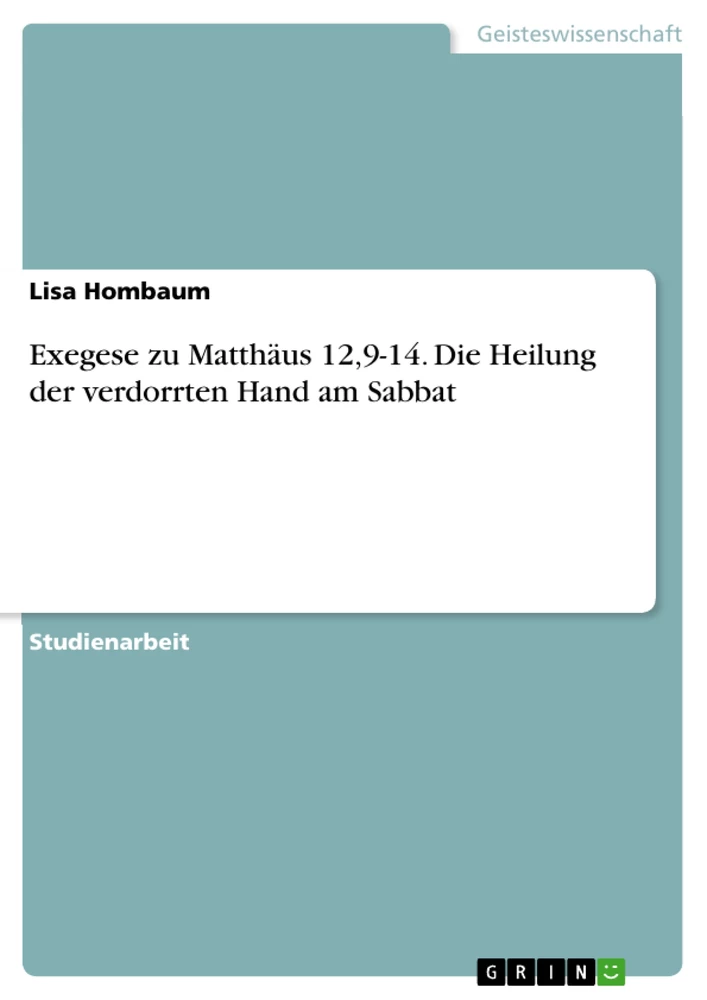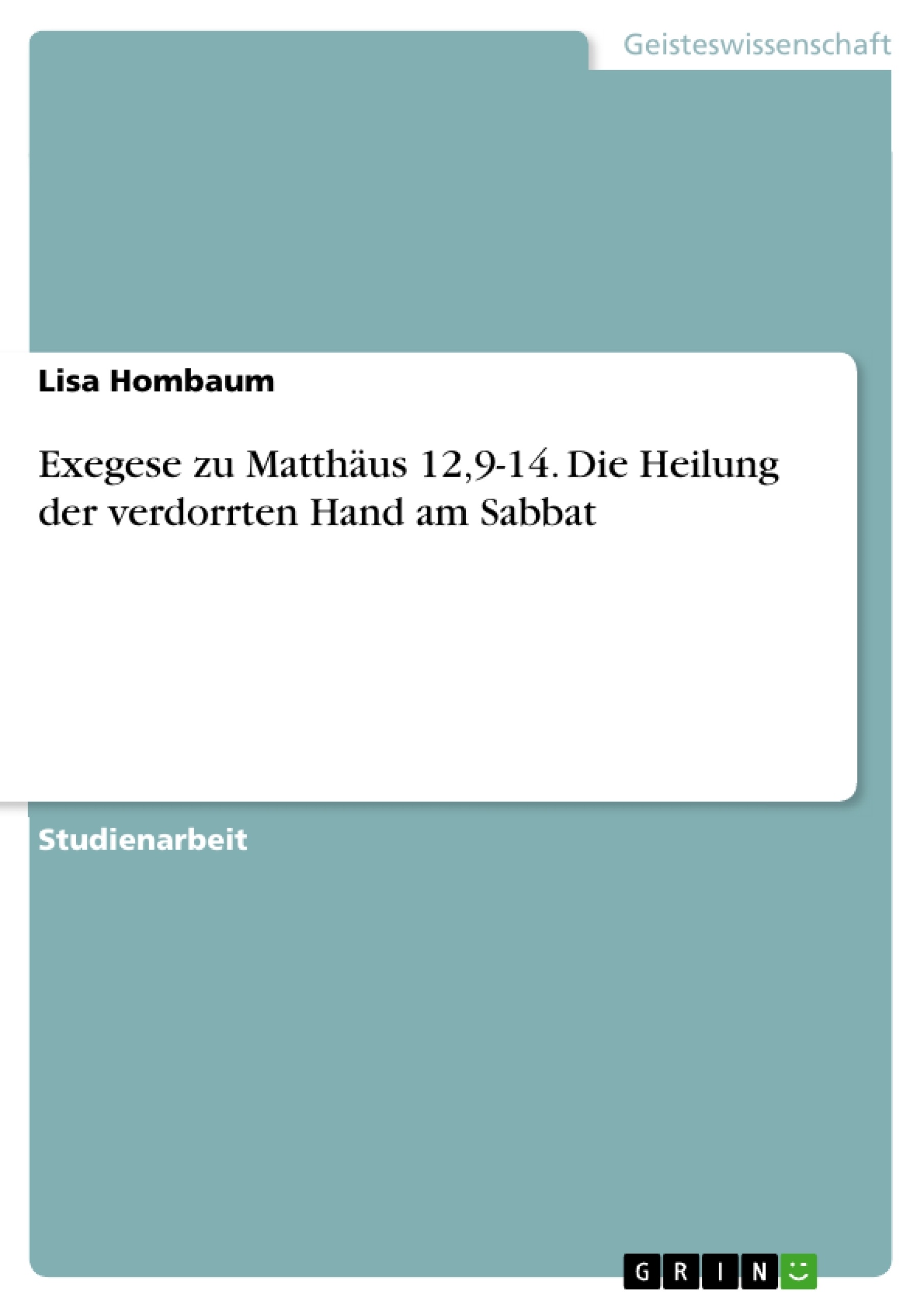Dies ist eine exegetische Arbeit zu der Perikope Matthäus 12,9-14 der Heilung der verdorrten Hand am Sabbat.
Eingeteilt in:
Übersetzungvergleich
Textanalyse
Literarkritik
Formgeschichte
Traditionsgeschichte
Redaktionsgeschichte
Gesamtinterpretation
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Übersetzungsvergleich
3. Textanalyse
3.1 Abgrenzung
3.2 Gliederung
3.3 Narrative Analyse
3.4 Syntaktische Analyse
3.5 Semantische Analyse
4. Literarkritik
5. Formgeschichte
6. Traditionsgeschichte
7. Redaktionsgeschichte
8. Gesamtinterpretation
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 25 Seiten
- nach oben