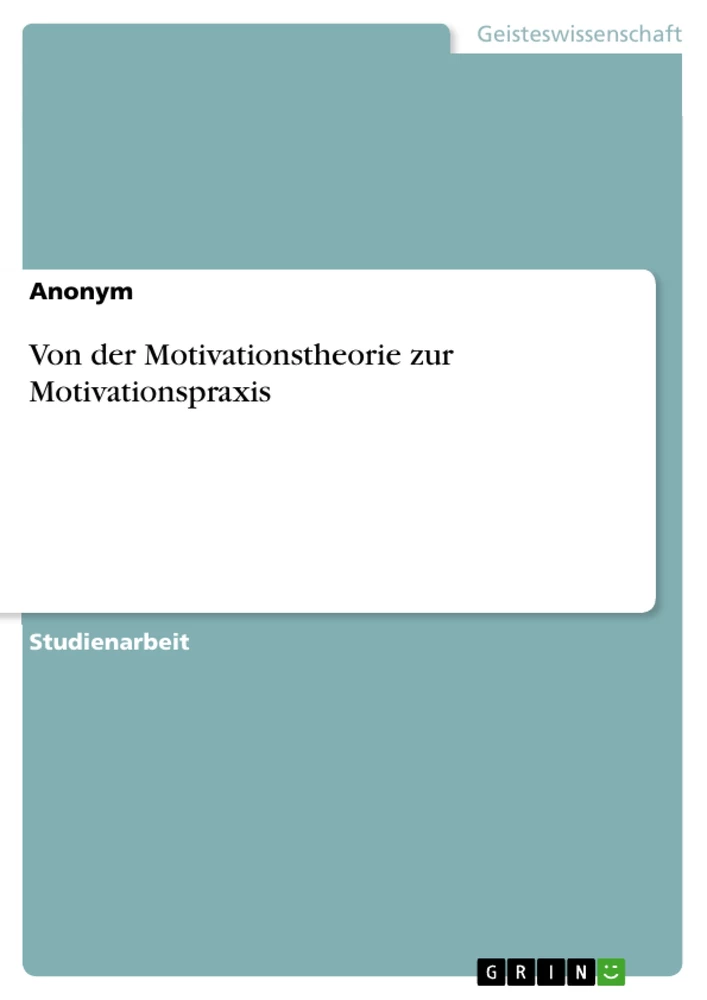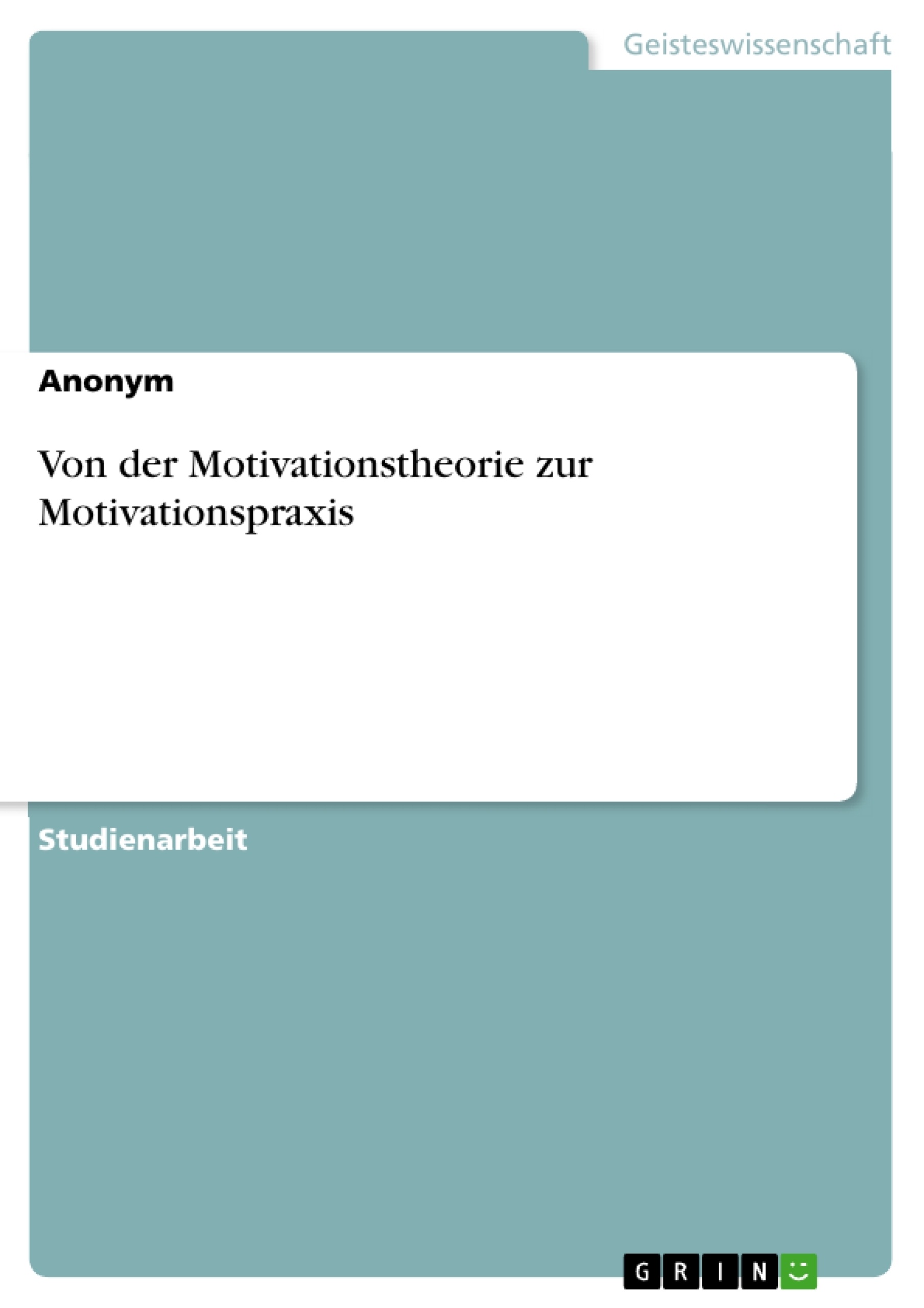In der heutigen Zeit spricht man sehr oft über Motivation der Mitarbeiter. Es ist zu einem der wichtigsten Faktoren für die Unternehmen geworden. Selbst die modernsten Maschinen und Produktionstechniken sind keine Garantie für Erfolg. Erst in Kombination mit engagierten Mitarbeitern, die ihr Fach verstehen und mit Leidenschaft ihre Aufgaben verrichten sind die Voraussetzungen für Erfolg und langfristiges bestehen am Markt gegeben. Ein Unternehmen soll kein Ort mehr sein, wo man nur das Geld verdient und starr die Regeln befolgt, es muss zu einem Teil des Lebens werden. Das Ziel der Motivation ist es, aus den Mitarbeitern, die dem Unternehmen gegenüber negativ eingestellt sind, aktive und wertvolle Teamspieler, die eigene Ideen einbringen und aktiv an Unternehmenszielen mitwirken zu entwickeln und langfristig zu erhalten. Doch wie schafft man die Mitarbeiter so zu motivieren? Bezüglich dieses Themas gibt es sehr viele unterschiedliche theoretische Auffassungen. In dieser Hausarbeit werde ich hierfür einige Vertreter vorstellen, sowie wage anhand eines praktischen Beispiels eine praxisbezogene Umsetzung.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Vorwort
2 Definitionen
2.1 Bedürfnisse
2.2 Motiv
2.3 Motivation
2.3.1 Intrinsische Motivation
2.3.2 Extrinsische Motivation
3 Ausgewählte Motivationstheorien
3.1 Inhaltstheorien
3.1.1 Theorien der Bedürfnishierarchie von Maslow
3.1.2 Zwei Faktorentheorie von Herzberg
3.2 Prozesstheorien
3.2.1 Die X-Y-Theorie
3.2.2 SIR-Theorien
4 Anwendungen von Motivationstheorien in der betrieblichen Praxis
4.1 Darstellung des Praxisfalles
4.2 Analyse
4.2.1 Analyse gemäß Maslow
4.2.2 Analyse gemäß Herzberg
4.3 Lösungsansätze
4.3.1 Lösung gemäß Maslow
4.3.2 Lösung gemäß Herzberg
5 Fazit
Literaturverzeichnis