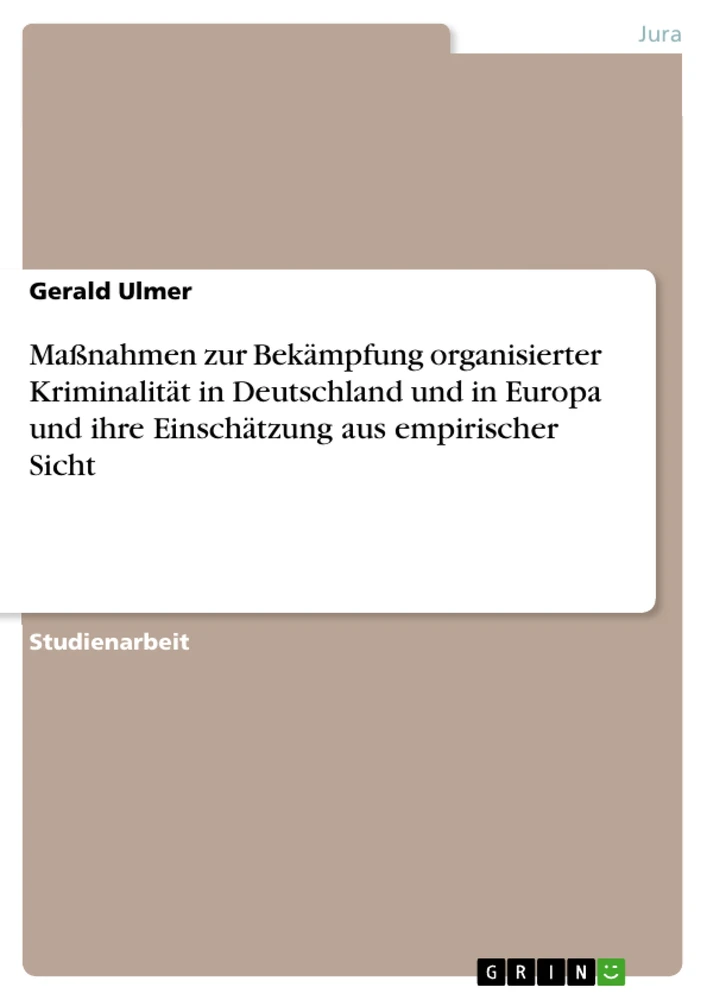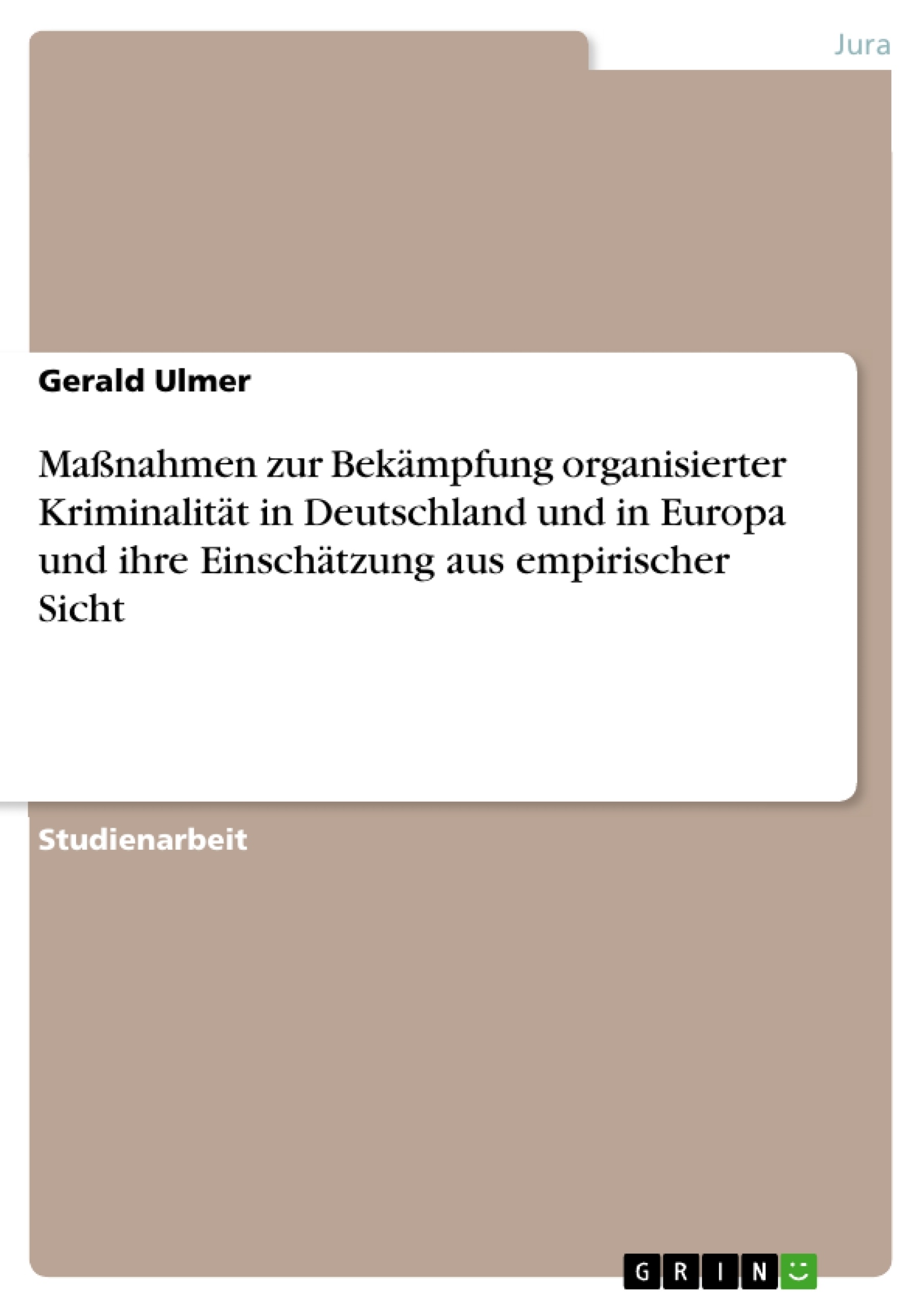“Organized crime is a common menace
without a common criminal code.“ (Harfield 2008, S. 484)
Bereits das Eingangszitat suggeriert die Allgegenwärtigkeit von organisierter Kriminalität. Und tatsächlich scheint es so, dass wir organisierter Kriminalität, zumindest der Begrifflichkeit selbst, beinahe täglich begegnen, sei dies in verschiedensten Unterhaltungsprogrammen oder im Rahmen der aktuellen Berichterstattung. Bereits Küster hob hervor, dass es im Hinblick auf organisierte Kriminalität längst nicht mehr um die Frage der Existenz gehe, sondern allenfalls darum, wie stark sie verbreitet sei. Aber wie steht es wirklich um dieses Phänomen? Und vor allem, was kann dieser Form der Kriminalität entgegengehalten werden? D.h., welche Maßnahmen der Bekämpfung der organisierten Kriminalität stehen zur Verfügung und wie wirkungsvoll sind sie?
Die Vielzahl der vorliegenden Phänomene, d.h. der Facettenreichtum der verschiedenen Formen der organisierten Kriminalität wirft bereits Fragen bezüglich der/den, verschiedensten Analysen zugrunde liegenden Definition(en), sowie der Kompatibilität, d.h. der Vergleichbarkeit der Ergebnisse auf. Außerdem wird oftmals, falls überhaupt, nur in beschränktem Umfang auf die zur Anwendung gelangenden Ermittlungsmaßnahmen eingegangen, geschweige denn auf deren Effizienz. Beides, d.h. die Definitionsproblematik und die im Zuge der Bekämpfung der organisierten Kriminalität zur Anwendung gelangenden Maßnahmen und deren Effizienz werden in den folgenden Kapiteln diskutiert und anhand von ausgewählten empirischen Forschungsergebnissen kontrastiert.
Inhaltsverzeichnis
1 ORGANISIERTE KRIMINALITÄT
1.1 UBIQUITÄT UND AMBIGUITÄT - EIN DEFINITIONSPROBLEM
1.2 ARBEITSDEFINITION
2 BEKÄMPFUNG ORGANISIERTER KRIMINALITÄT
2.1 DEUTSCHES RECHT
2.1.1 Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG)
2.1.2 Geldwäschegesetz, Gesetzüber das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
2.1.3 „ Verbrechensbekämpfungsgesetz “ (Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung und anderer Gesetze)
2.1.4 Gesetz zur Bekämpfung der Korruption
2.1.5 Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität
2.2 EUROPÄISCHES/INTERNATIONALES RECHT
2.3 MAßNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT - EMPIRISCHE ERKENNTNISSE
3 AUSBLICK
LITERATURVERZEICHNIS
ANNEX A: UNODC -REPORT; TRENDANGABEN HINSICHTLICH DER VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER VERSCHIEDENEN OK-PHÄNOMENE