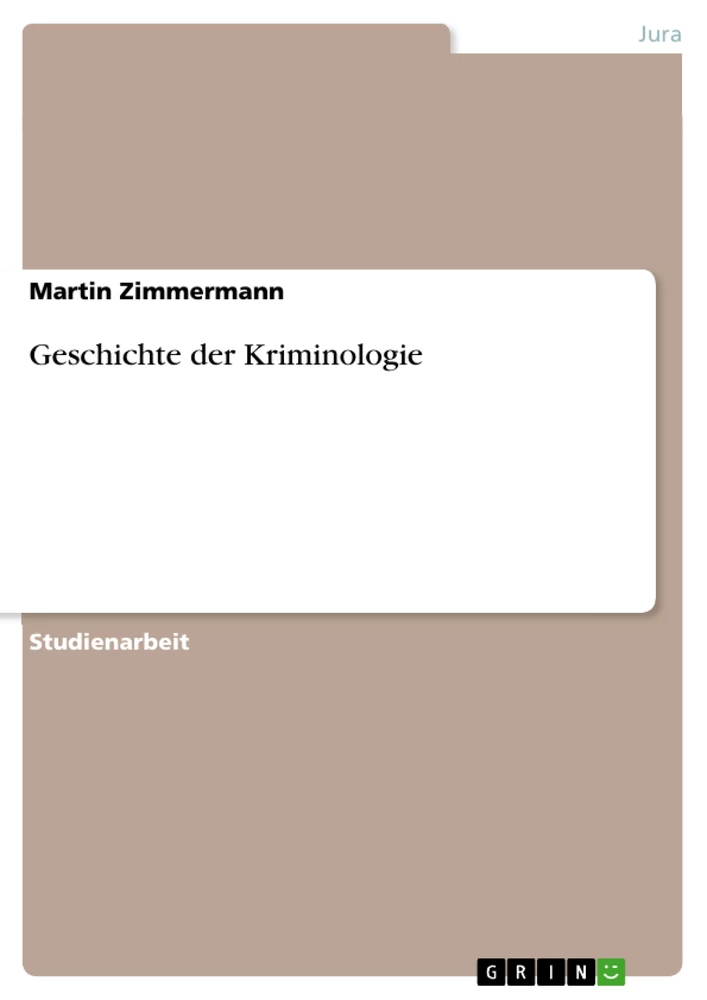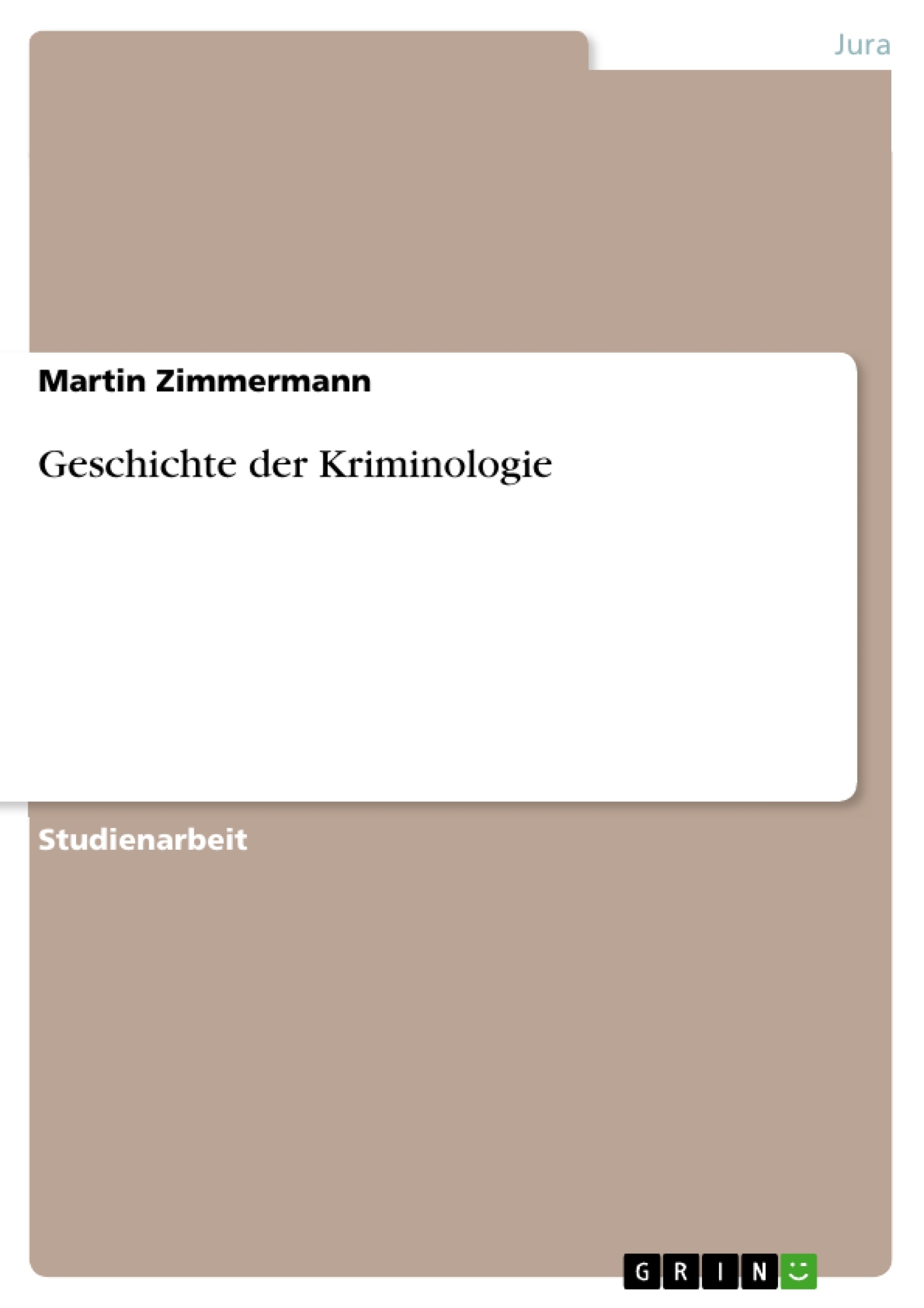1.Einleitung
2. Geschichte der Kriminologie
2.1.Vorläufer und empirische Ansätze
2.2 Erste theoretischen Impulse der klassische Schule der Kriminologie
2.2.1 Cesare Beccaria als Begründer der klassischen Kriminologie
2.2.2 Weitere Vertreter der klassischen Schule
2.2.3 Auswirkungen der klassischen Schule
2.3 Die positivistische Kriminologie
2.3.1 Ursprung der anthropologischen Schule
2.3.2 Italienisch- krimalanthropologische Schule
2.3.2.1 Cesare Lombroso: Begründer der empirischen Kriminologie
2.3.2.2 Weitere Vertreter der italienischen Schule
2.3.2.3 Relevanz der italienischen Schule für die Kriminologie
2.3.3 Französisch- kriminalsoziologische Schule
2.3.3.1 Vorläufer der Kriminalsoziologie
2.3.3.2 Kriminalsoziologische Ansätze von Tarde, Lacassagne und Durkheim
2.3.3.3Auswirkungen der französischen Schule auf die Kriminologie
2.3.4 Vereinigungslehre Franz von Liszt
2.4 Nordamerikanische Kriminologie gegen Ende des 19. bis zur Mitte des 20.Jahrhunderts
2.4.1 Kinderretterbewegung
2.4.2 Ansätze einer klinischen Kriminologie
2.4.3 Empirisch ausgerichteter Mehrfaktorenansatz Glueck
2.4.4 Entwicklung der Kriminalökologie in Chicago Shaw/McKay
2.4.5 Organisierten Kriminalität Thrasher
2.4.6 Die Wurzeln der „radikalen Kriminologie“ (Labeling Approach)
2.4.7 Frauenkriminalität (Parmelee)
2.4.8 Anfänge einer Viktimologie von Hentig
2.4.9 Anfänge einer vergleichenden Kriminologie Reckless
2.4.10 Sutherlands Einfluss auf die Kriminologie
2.5 Kriminologische Entwicklung in Deutschland
2.5.1 Deutsche Entwicklung am Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre
2.5.2 Kriminologie im „Dritten Reich“
2.5.3 Kriminologie in der ehemaligen DDR
2.5.4 Die deutsche Kriminologie nach dem 2. Weltkrieg in den alten Bundesländern
2.6 Die amerikanische Kriminologie nach dem 2. Weltkrieg
2.6.1 Paradigmawechsel der Kriminologie "Labeling Approach“
2.6.1.1 Labeling Approach
2.6.1.2 Relevanz und Kritik des Labeling Approach
2.6.1.3 Auswirkungen des Labeling Ansatzes auf die deutsche Kriminologie
3. Zusammenfassung und Ausblick
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
2. Geschichte der Kriminologie
2.1.Vorläufer und empirische Ansätze
2.2 Erste theoretischen Impulse der klassische Schule der Kriminologie
2.2.1 Cesare Beccaria als Begründer der klassischen Kriminologie
2.2.2 Weitere Vertreter der klassischen Schule
2.2.3 Auswirkungen der klassischen Schule
2.3 Die positivistische Kriminologie
2.3.1 Ursprung der anthropologischen Schule
2.3.2 Italienisch- krimalanthropologische Schule
2.3.2.1 Cesare Lombroso: Begründer der empirischen Kriminologie
2.3.2.2 Weitere Vertreter der italienischen Schule
2.3.2.3 Relevanz der italienischen Schule für die Kriminologie
2.3.3 Französisch- kriminalsoziologische Schule
2.3.3.1 Vorläufer der Kriminalsoziologie
2.3.3.2 Kriminalsoziologische Ansätze von Tarde, Lacassagne und Durkheim
2.3.3.3Auswirkungen der französischen Schule auf die Kriminologie
2.3.4 Vereinigungslehre Franz von Liszt
2.4 Nordamerikanische Kriminologie gegen Ende des 19. bis zur Mitte des 20.Jahrhunderts
2.4.1 Kinderretterbewegung
2.4.2 Ansätze einer klinischen Kriminologie
2.4.3 Empirisch ausgerichteter Mehrfaktorenansatz Glueck
2.4.4 Entwicklung der Kriminalökologie in Chicago Shaw/McKay
2.4.5 Organisierten Kriminalität Thrasher
2.4.6 Die Wurzeln der „radikalen Kriminologie“ (Labeling Approach)
2.4.7 Frauenkriminalität (Parmelee)
2.4.8 Anfänge einer Viktimologie von Hentig
2.4.9 Anfänge einer vergleichenden Kriminologie Reckless
2.4.10 Sutherlands Einfluss auf die Kriminologie
2.5 Kriminologische Entwicklung in Deutschland
2.5.1 Deutsche Entwicklung am Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre
2.5.2 Kriminologie im „Dritten Reich“
2.5.3 Kriminologie in der ehemaligen DDR
2.5.4 Die deutsche Kriminologie nach dem 2. Weltkrieg in den alten Bundesländern
2.6 Die amerikanische Kriminologie nach dem 2. Weltkrieg
2.6.1 Paradigmawechsel der Kriminologie "Labeling Approach“
2.6.1.1 Labeling Approach
2.6.1.2 Relevanz und Kritik des Labeling Approach
2.6.1.3 Auswirkungen des Labeling Ansatzes auf die deutsche Kriminologie
3. Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis