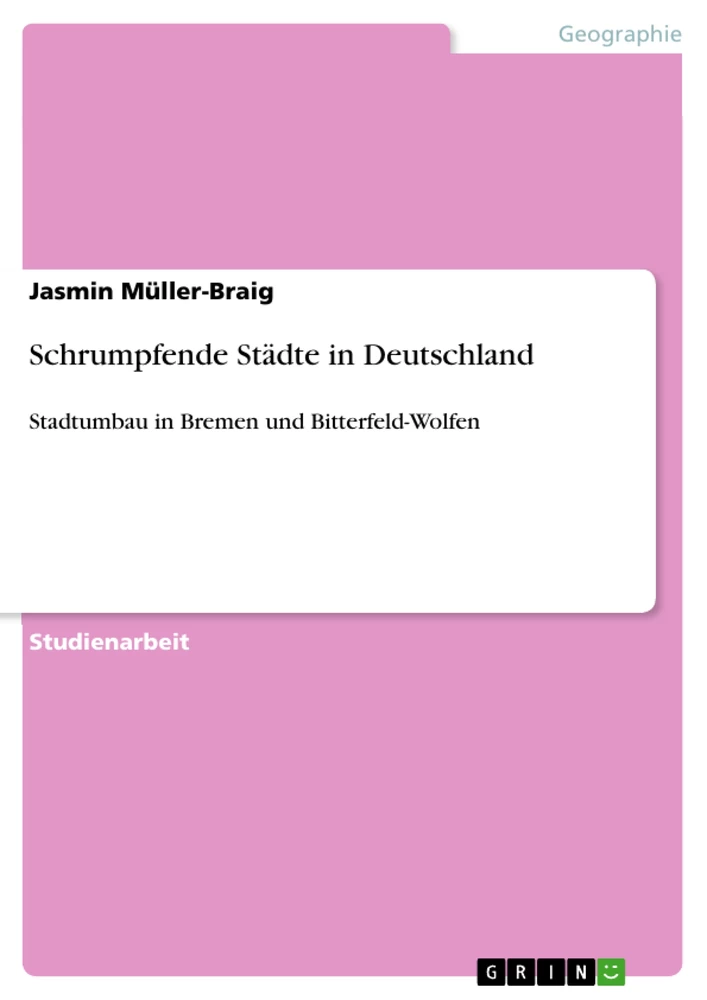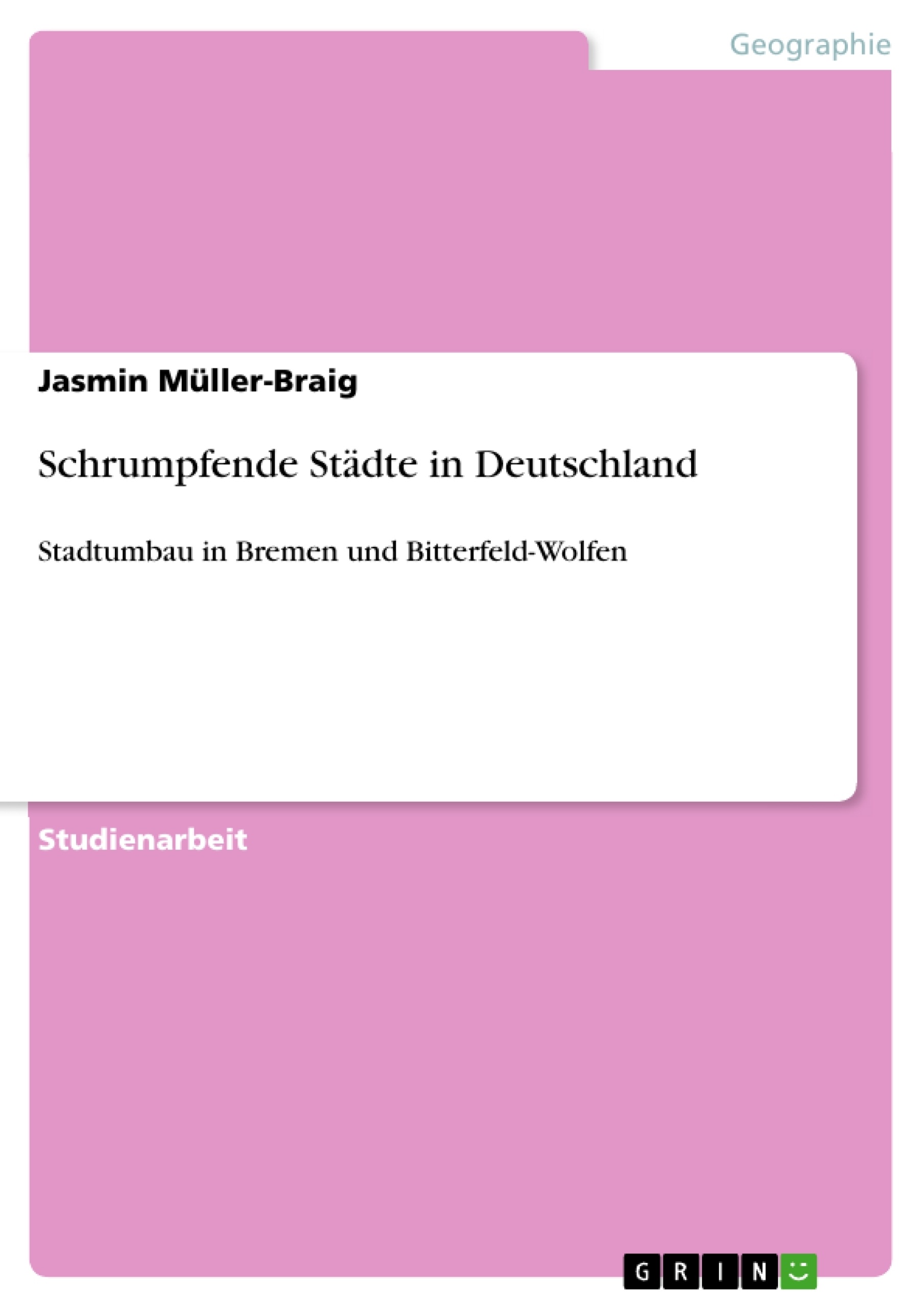In der Hausarbeit geht es um das dem Thema der Stadtschrumpfung. Das impliziert die Auseinandersetzung mit den grundlegenden Faktoren für Schrumpfungsprozesse, ihren Auswirkungen auf die Stadt und die Bevölkerung sowie den raumplanerischen Möglichkeiten, auf den Prozess zu reagieren. Ziel ist es, anhand von Beispielen – diese seien Bremen und Bitterfeld-Wolfen – einen Bogen zu spannen zwischen der bloßen Theorie der Stadtschrumpfung und konkreten Schrumpfungsprozessen sowie Fallbeispielen des darauf folgenden Stadtumbaus. Der Schwerpunkt der Ausarbeitung liegt auf der Analyse des Schrumpfungsprozesses und den Möglichkeiten der Reaktion. Hier wird vor allem auf die Pläne des Stadtumbau Ost sowie des Stadtumbau West eingegangen. Außerdem soll das Initiativprojekt „shrinking cities“ der Kulturstiftung des Bundes als Beispiel zur Auseinandersetzung mit der Thematik aufgezeigt werden. Abschließend werden die Ergebnisse im Fazit kurz zusammengefasst. Darüber hinaus soll ein Ausblick auf die Stadtentwicklung in Deutschland im 21 Jahrhundert erfolgen.
Inhaltsverzeichnis:
1 Einleitung
2 Stadtschrumpfung – Gründe, Auswirkungen, Erscheinungen
3 Raumplanerische Reaktionen auf Schrumpfungsprozesse
4 Die Förderprogramme „Stadtumbau Ost“ und „Stadtumbau West“
5 Stadtumbau am Beispiel von Bitterfeld-Wolfen
6 Stadtumbau am Beispiel von Bremen
7 Fazit
8 Literaturverzeichnis