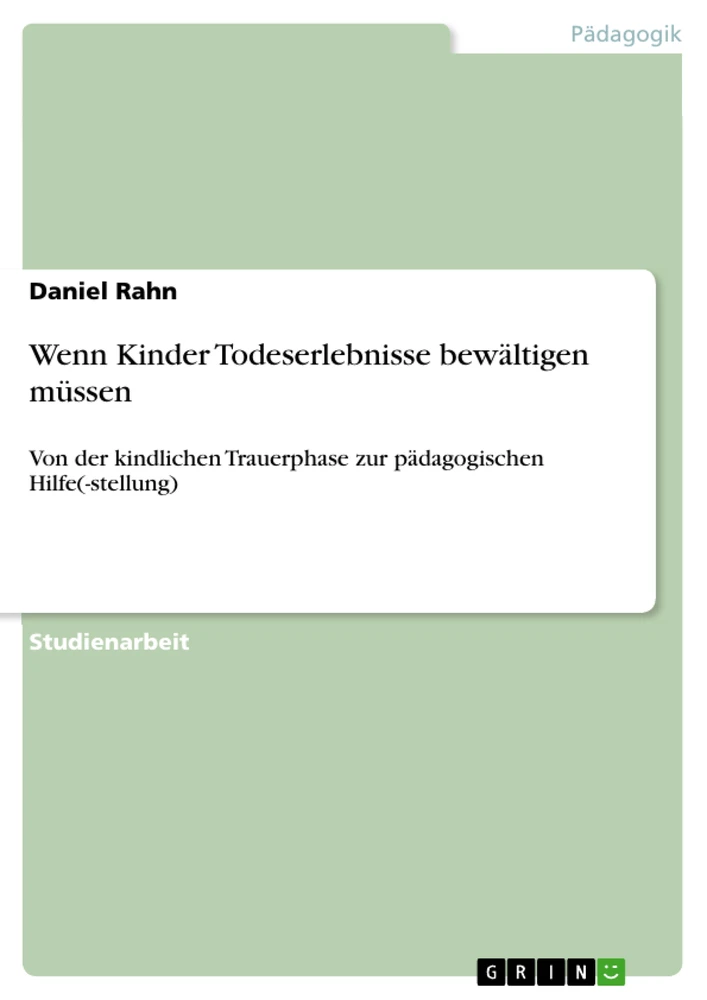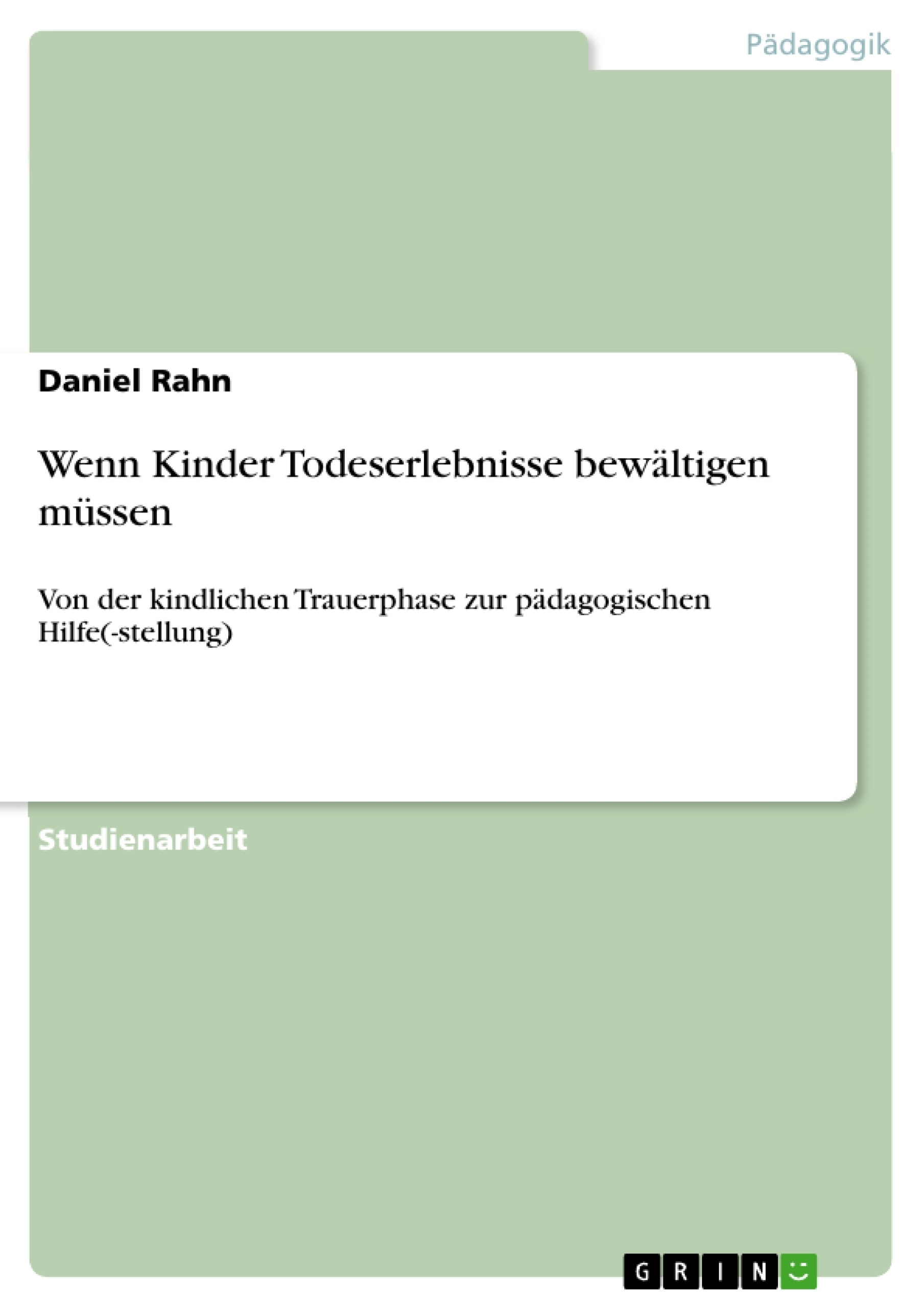Mit Kindern assoziiert und verbindet man vornehmlich Spielen, Lachen, Freude und Lernen. Trauer wird deshalb selten mit ihnen in Verbindung gebracht, obwohl „traurig sein“ zu jedem Leben dazu gehört. Dies obwohl Trauer eine natürliche Reaktion auf schmerzliche Erfahrun-gen wie bspw. Trennung, Verlust sowie Abschied und Tod ist, eine Erfahrung im Leben, die Kinder genauso wie Erwachsene begleitet (vgl. Specht-Tomann, Tropper 2001, 49). Gerade weil Kinder häufig dem Tod in Medien und Gesellschaft begegnen, dieser aber zugleich in gewisser Weise tabuisiert wird (vgl. Hinderer, Kroth 2005, 5ff; Bogyi 1999, 126), ist es von Bedeutung, diesen durch Sprechen über den Tod der Tabuisierung zu entreißen. Dies kann dann zu aufklärenden Gesprächen über Tod und Sterben führen – was gerade für Kinder wichtig ist – und hilft somit „wissender“ oder „vorbereiteter“, kurz aufgeklärter, zu sein, was wiederum Einfluss auf die Trauerbewältigung haben kann.
Mit dieser Arbeit möchte ich im Allgemeinen die Aufgabe der Trauer und ihren Verlauf skiz-zieren, im Speziellen den kindlichen Trauerprozess – inklusive seiner Einflussfaktoren und evtl. auftretender Missverständnisse dieses Prozesses – darstellen und im Konkreten versu-chen, unterstützende Maßnahmen für eine positive Trauerbewältigung aufzuzeigen. Weiterhin soll diese Arbeit dazu beitragen, ein besseres und differenzierteres Verständnis des kindlichen Trauerprozesses zu erlangen. Im ersten Teil dieser Arbeit werde ich mich den Aufgaben der Trauer, den Trauerprozessen von Erwachsenen und Kindern widmen und ggf. Unterschiede aufzeigen. Des Weiteren werde ich die familiären Einflussfaktoren auf den kindlichen Trau-erprozess eingehen, bevor ich mich im zweiten Teil der Arbeit auf Auswege und (präventive) Ansätze zur Unterstützung der kindlichen Trauerbewältigung fokussiere.
Um sich mit dem Thema hinreichend auseinander setzten zu können, lohnt es sich, einige Definitionen des Trauerprozesses und des Begriffes Trauer zu betrachten, um erstens eine bessere, respektive genauere Vorstellung von Trauer, ihrem Sinn und Zweck zu erlangen und zweitens den Grundstein bzw. einen einheitlichen Konsens zu legen, auf dem die gesamte spätere Arbeit fußt.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass Trauerarbeit wie wir sie derzeit kennen und – z.T. in abge-wandelter Form – betreiben, erst seit etwa einhundert Jahren als „Trauerarbeit“ angesehen wird. Hierzu hat vor allem Sigmund Freud beigetragen, als er sein psychoanalytisches Modell...
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Trauerprozess
2.1 Aufgaben der Trauer
2.2 Exkurs: Wie trauern Erwachsene?
2.3 Wie trauern Kinder?
2.3.1 Kindliche Bilder und Vorstellungen von und über den Tod
2.3.2 Kindlicher Trauerprozess
2.4 Familiäres Umfeld und Einflussfaktoren des kindlichen Trauerprozesses
3. (Aus-)Wege und Ansätze zur Unterstützung der Trauerbewältigung
4. Resümee und Ausblick
5. Anhang
6. Literaturverzeichnis
7. Internetverzeichnis