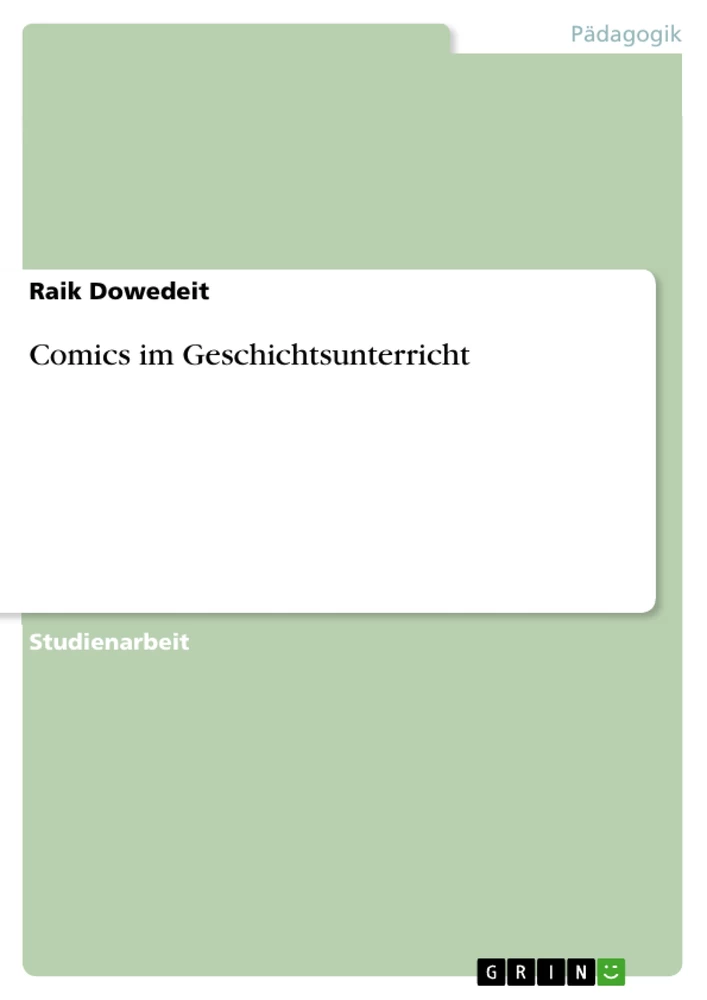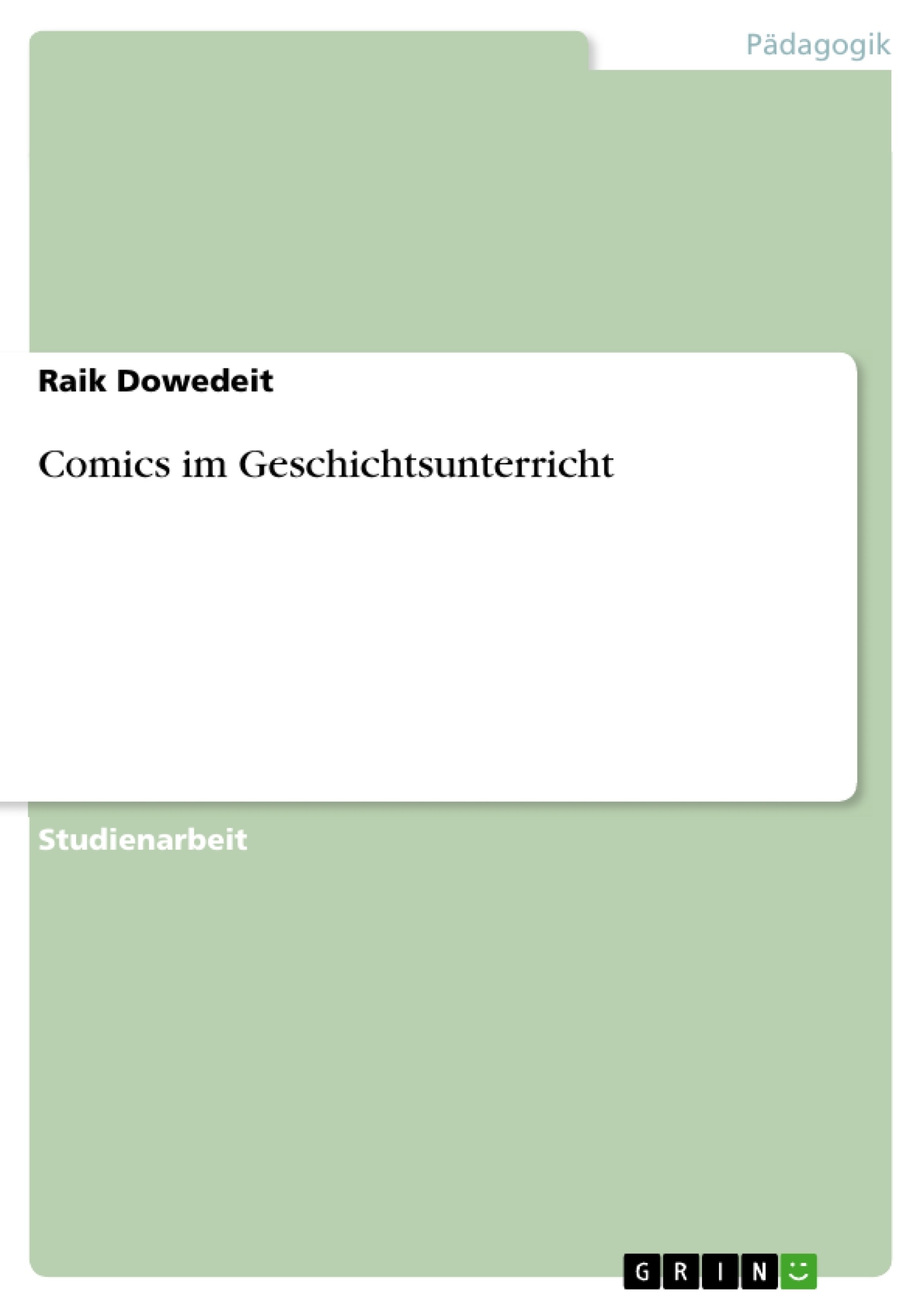In den fünfziger und sechziger Jahren wurde der Comic als die Schundliteratur schlechthin abgetan. Pädagogen, Jugendämter, Kirchen sowie die öffentliche Meinung führten einen regelrechten Ablehnungsfeldzug gegen Comics. Durch Nachahmung sollte es die Kinder zur Kriminalität und Gewaltanwendungen verleiten und gleichzeitig zur Verkümmerung des sprachlichen Artikulationsvermögens führen. Erst mit „Asterix“, in den siebziger Jahren, begann sich die ablehnende Haltung gegenüber Comics langsam
aufzulösen. Doch dauerte es noch bis in die achtziger Jahre, ehe der Comic auch in ersten Ansätzen in fachdidaktischen Diskussionen zum Thema wurde.
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit dem Comic und im Besonderen mit dem historischen Comic, auch Geschichtscomic genannt, und dessen Möglichkeiten im Geschichtsunterricht. Dazu wird zunächst eine Unterteilung der Arbeit in zwei Hauptabschnitte unternommen. Der erste Teil wird sich mit den Elementen des Comics, sowie seinem narrativen Aufbau beschäftigen. Im zweiten Abschnitt wird schließlich auf den Comic im Geschichtsunterricht eingegangen werden, dazu soll zum einen eine Typologie der Comics und deren Wertigkeit für den Geschichtsunterricht und zum anderen der Nutzen und die Einsatzmöglichkeiten im Geschichtsunterricht herausgearbeitet werden.
Inhalt
Einleitun
1. Das Comic
1.1. Was ist ein Co
1.2. Aufbau und Funktion des Comics
1.3. Narrativer Aufbau des Comics
2. Comics im Geschichtsunterricht
2.1. Typologie von Geschichtscomics
2.2. Nutzen und Anwendungsmöglichkeiten von Comics im Geschichtsunterricht
Resümee
Quellen- und Literaturverzeichnis