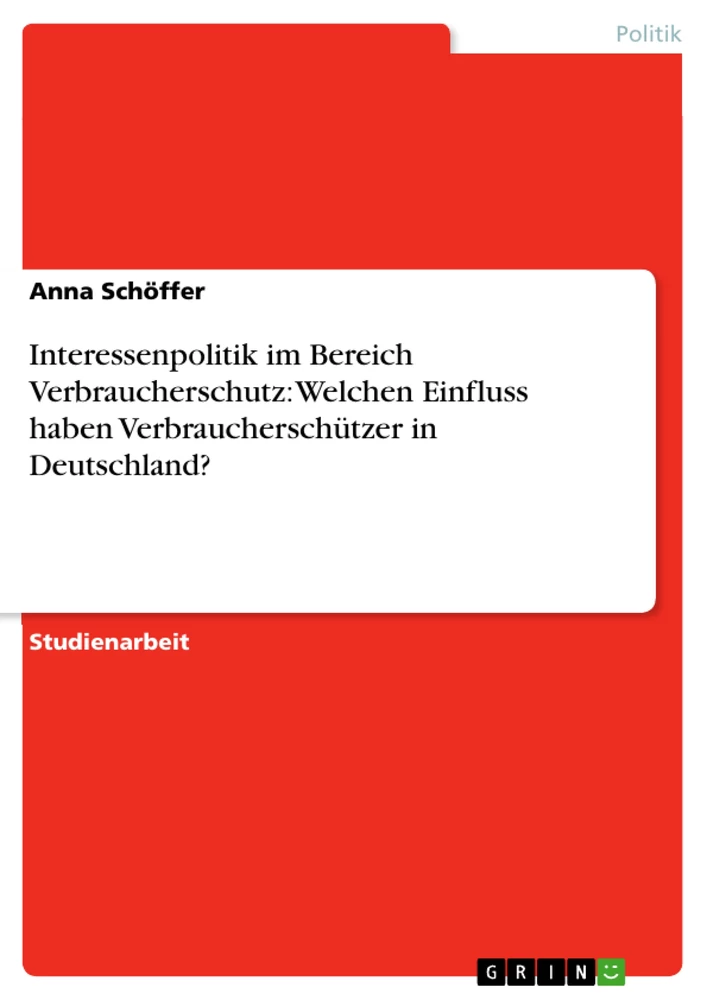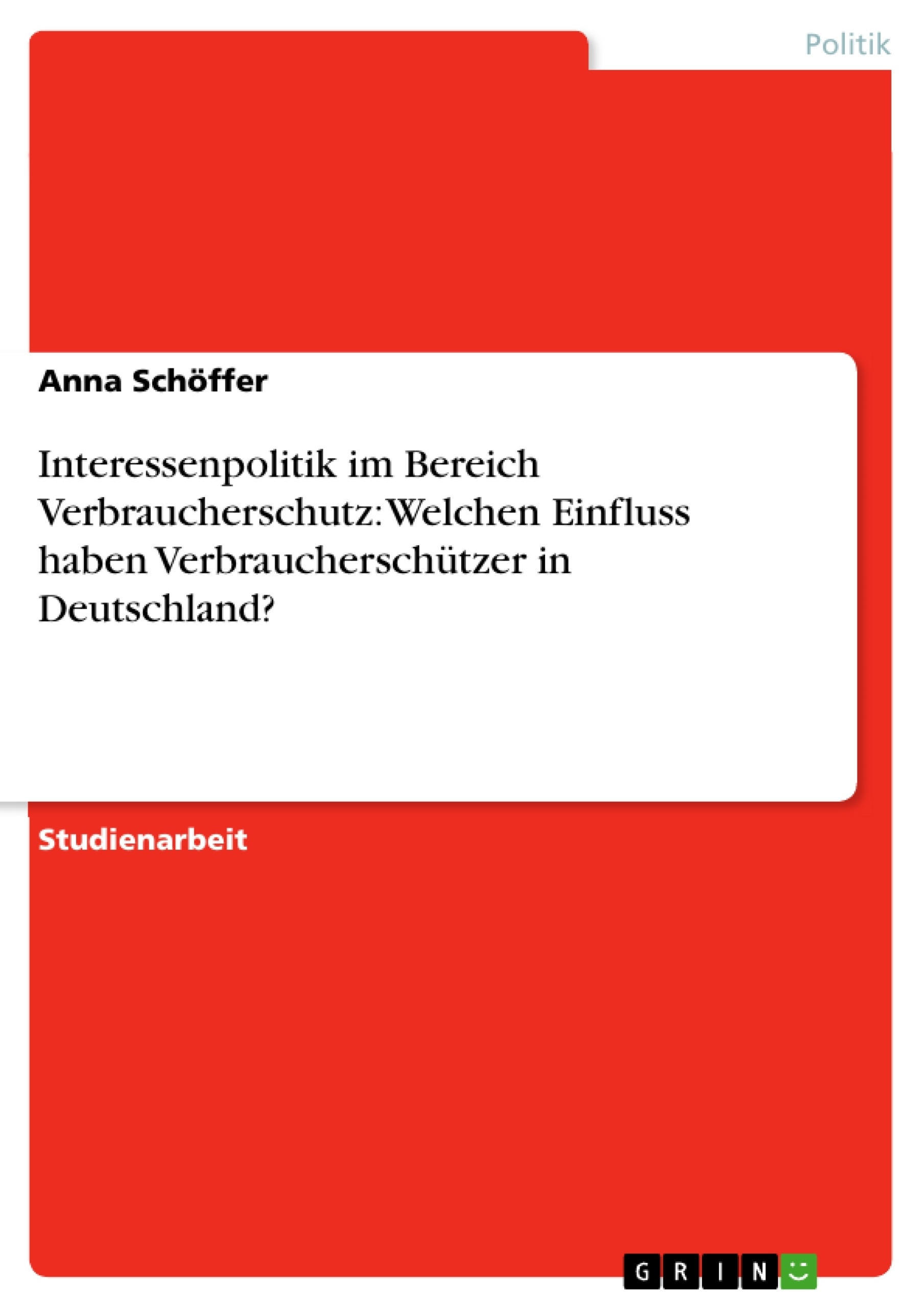1. Was bedeutet Verbraucherschutz eigentlich?
Das Thema Verbraucherschutz findet sich in letzter Zeit wieder verstärkt auf der
politischen Agenda. Auslöser dafür sind vor allem der so genannte Gammelfleischskandal
und die Diskussion um ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden.
In meiner Hausarbeit widme ich mich dem Thema „Interessenpolitik im Bereich
Verbraucherschutz“, hierbei möchte ich die Frage wie stark die Verbraucherinteressen in
der BRD vertreten werden, besonders thematisieren. Liest man allgemeine Literatur zum
Thema Interessenpolitik in der BRD1 wird immer wieder betont, dass die
Verbraucherinteressen nur eine marginale Rolle spielen und schwer zu vertreten sind. Ich
möchte nun herausarbeiten inwieweit diese Aussagen wirklich zutreffen und
gegebenenfalls untersuchen wie weit entwickelt die Artikulationsfähigkeit, die
Organisationsfähigkeit und die Konfliktfähigkeit von Verbraucherinteressen ist. Anhand
der Ergebnisse werde ich Chancen und Folgen für die zukünftige Arbeit der
Verbraucherorganisationen aufzeigen. Außerdem beschäftige ich mich mit der historischen
Entwicklung des Verbraucherschutzes und beziehe die betroffenen Akteure und ihre
Strategien zur Interessendurchsetzung in meine Überlegungen mit ein.
Zunächst sollte man sich über die Begriffe „Verbraucher“ und „Verbraucherschutz“ im
Klaren sein. Im Bürgerlichen Gesetzbuch § 13 wird Verbraucher wie folgt definiert:
„Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann“ (Wasmund 2007: 10). Diese Definition ist relativ abstrakt und dürfte nicht jedem
sofort verständlich sein. Konkreter ist eine Definition, die sich im Lexikon der Wirtschaft
der Bundeszentrale für politische Bildung finden lässt. Der Verbraucher bzw. Konsument
ist „der Käufer, Endverbraucher oder Letzverwender von Gütern und Dienstleistungen.
Konsumenten im wirtschaftlichen Sinne können einzelne Personen, Haushalte oder größere
Gruppen von Personen sein.“
Inhaltsverzeichnis
l.Was bedeutet Verbraucherschutz eigentlich?
2. Verbraucherschutz in Deutschland - die historische Entwicklung
3. Warum sind Verbraucherinteressen in der BRD so schwach vertreten? Theoretische Überlegungen
4. Akteure im Policyfeld Verbraucherschutz
4.1. Die staatlichen Akteure
4.1.1. Die Bundesregierung und ihre verbraucherpolitischen Ziele in der aktuellen Legislaturperiode
4.1.2. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
4.1.2.1. Entwicklung, Aufbau und Organisation des Bundesministeriums
4.1.2.2. 10-Punkte-Erfolgsbilanz unterHorstSeehofer
4.1.3. Das Verbraucherinformationsgesetz
4.1.4. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
4.1.5. Das Bundeskartellamt
4.1.6. Bewertung des staatlichen Handelns
4.2. Die zivilgesellschaftlichen Akteure
4.2.1. Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. - die Stimme der Verbraucher
4.2.2. Verbraucherzentralen der Länder - am Beispiel Bayern
4.2.3. Institut für angewandte Verbraucherforschung - IFAV
4.2.4. Stiftung Warentest
4.2.5. Allgemeiner deutscher Automobil-Club e. V.
5. Vorschläge für einen besseren Verbraucherschutz
Literaturverzeichnis
Anhang