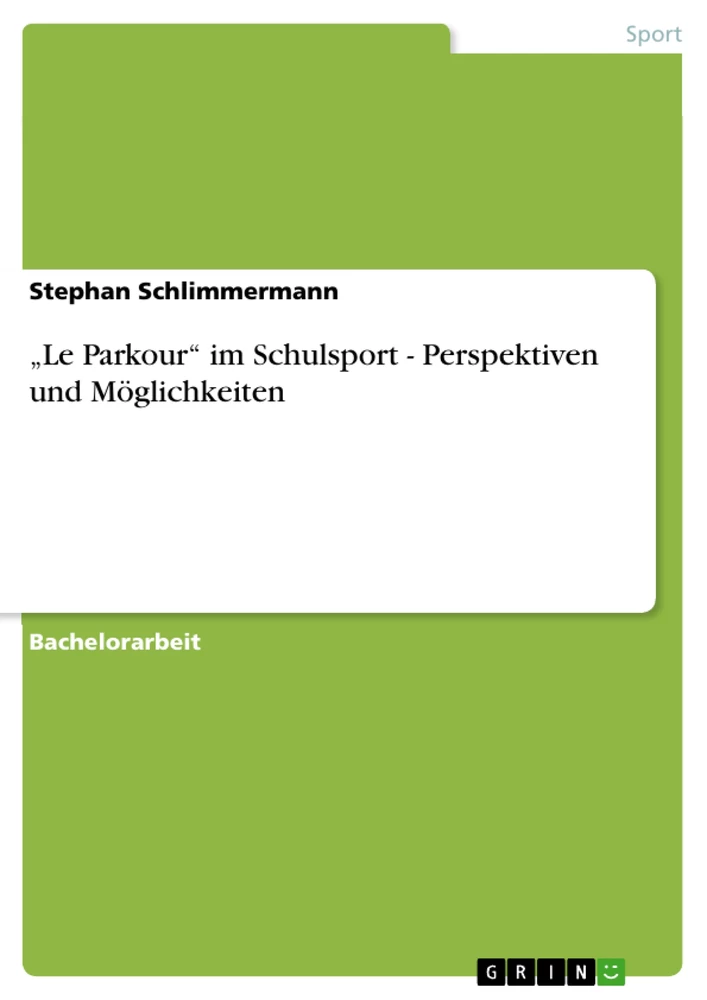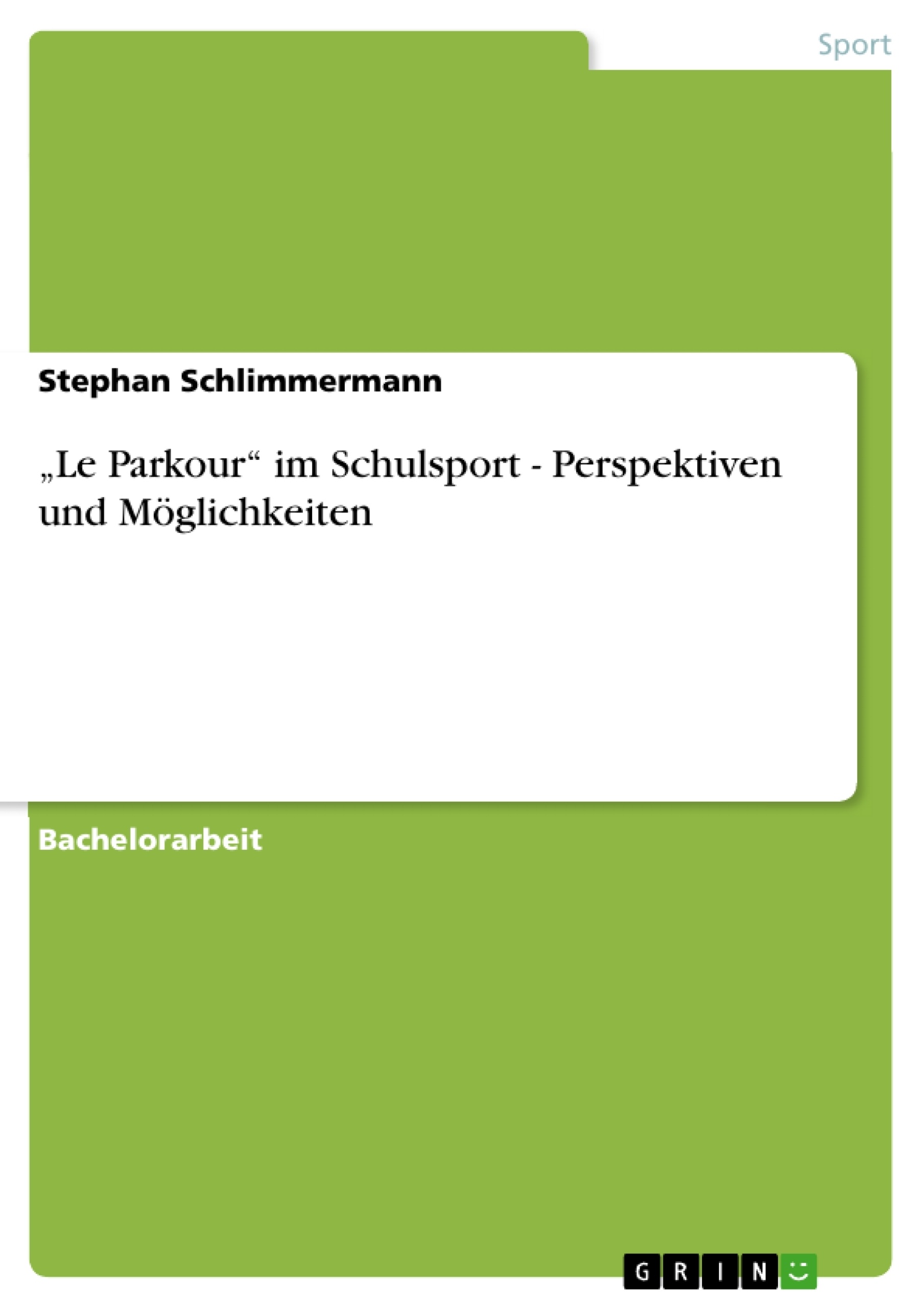„Mein Traum war es, einmal wie Spiderman von Dach zu Dach zu schwingen“, sagte David Belle in einem Interview zu der Sportart „Le Parkour“. Ihn selbst kann man in dem Video dabei beobachten, wie er Wände hinaufläuft, von Hausdach zu Hausdach springt und sich scheinbar mühelos von Fenstersims zu Fenstersims hangelt. Auf den Laien mag dies kindisch, waghalsig oder auch verrückt wirken, aber hinter diesen Aktionen steckt eine Intention, vielmehr noch eine Botschaft. Der charismatische Franzose wurde nicht dabei gefilmt, wie er sich Zuhause ausgeschlossen hat und nun versucht, sich durch das Fenster einen Weg zurück in die Wohnung zu bahnen. Mitnichten, denn David Belle wird als Gründer der Sportart „Le Parkour“ gesehen und möchte in diesem Video die Menschen auf diese eigentümliche, aber auch anspruchsvolle Sportart aufmerksam machen. Und er hat Erfolg. Parkour erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit und findet sogar über die Grenzen Frankreichs hinweg Anhänger. Auch in Filmen wie „Casino Royal“ wird Le Parkour aufgegriffen und in „Ghettogangz – Die Hölle von Paris“ gibt sich der Erfinder selbst die Ehre, seinen Sport in den Film einzubeziehen. Doch was sind die zentralen Ideen von „Le Parkour“ und wo hat dieser Sport seinen Ursprung? Wer übt diese Sportart aus und welche Umgebung ist dafür gefordert? Unter welchen Bedingungen kann es möglich sein, „Le Parkour“ in den Schulsport aufzunehmen und wie kann eine Umsetzung konkret aussehen? Diesen Fragen soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden. Dazu wird zunächst David Belle und der Ursprung seines Sports näher beleuchtet und anschließend ein Einblick in das Bewegungsspektrum der Traceure, wie die Protagonisten von Parkour genannt werden, gegeben. Um den Einzug von „Le Parkour“ in die Schulpädagogik zu diskutieren, wird der Lehrplan für Schleswig-Holstein der Sekundarstufe 1 herangezogen und auf eine sinnvolle Einbettung in den Unterricht geprüft. Abschließend wird durch die Vorstellung einer Unterrichtseinheit ein Beispiel gegeben, wie eine erfolgreiche Umsetzung von „Le Parkour“ im Schulsport gelingen kann.
Inhalt
1. Einleitung
2. Themenfindung
2.1 „Le Parkour“
2.2 David Belle
2.3 Philosophie
2.4 Das Wesen von „Le Parkour“
2.5 Bewegungsmuster im Parkour
3. Verbreitung von „Le Parkour“
3.1 Verbreitung in Frankreich
3.2 Aktuelle Verbreitung
4. Lehrplan
4.1 Vergleiche mit dem Lehrplan Schleswig Holstein für die Sekundarstufe 1
4.1.1 Das Konzept der Grundbildung
4.1.2 Auseinandersetzung mit den Kernproblemen
4.2 Didaktische Begründungen:
4.2.1 Themenbereiche
4.2.2. Sich fit halten
4.2.3. An Geräten turnen
4.2.4 Laufen, Springen, Werfen
5. Le Parkour im Schulsport
5.1 Interne Bedingungen
5.2 Externe Bedingungen
5.3. Hinweise
5.4. Groblernziel der Stunde:
5.5. Feinlernziele der Stunde:
5.5.1 kognitiv
5.5.2 sozial affektiv
5.6 Methodische Begründungen
5.7 Verlaufsskizze:
5.8 Stationsaufbauten
5.8.1 Stationsaufbau der ersten Unterrichtseinheit
5.8.2 Stationsaufbau der zweiten Unterrichtseinheit
5.9 Reflexion
6. Möglichkeiten
7. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis