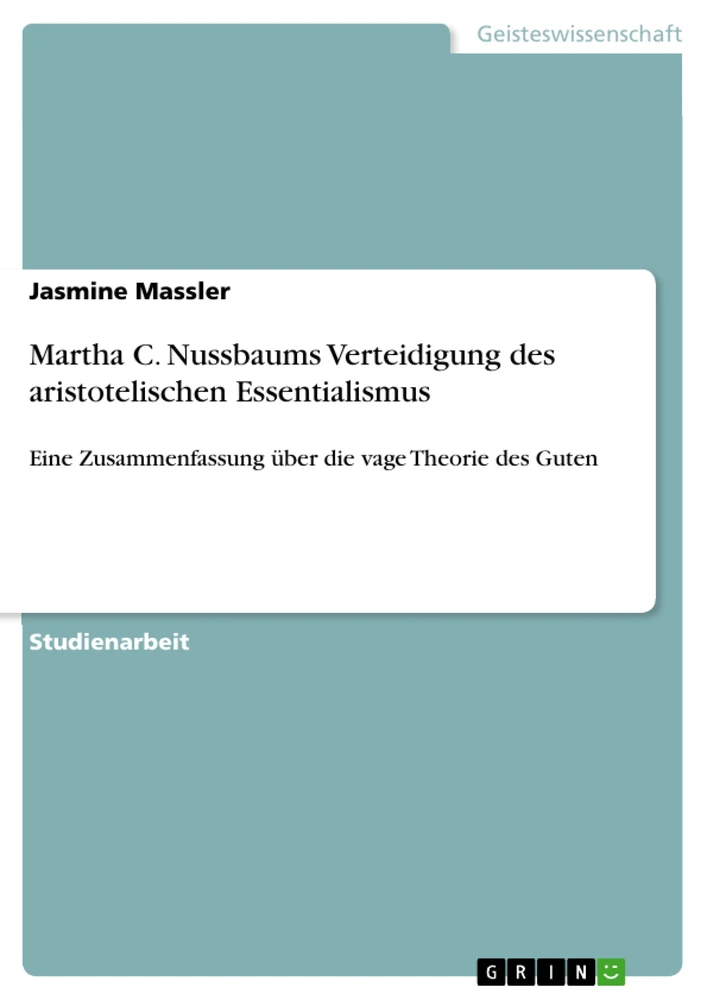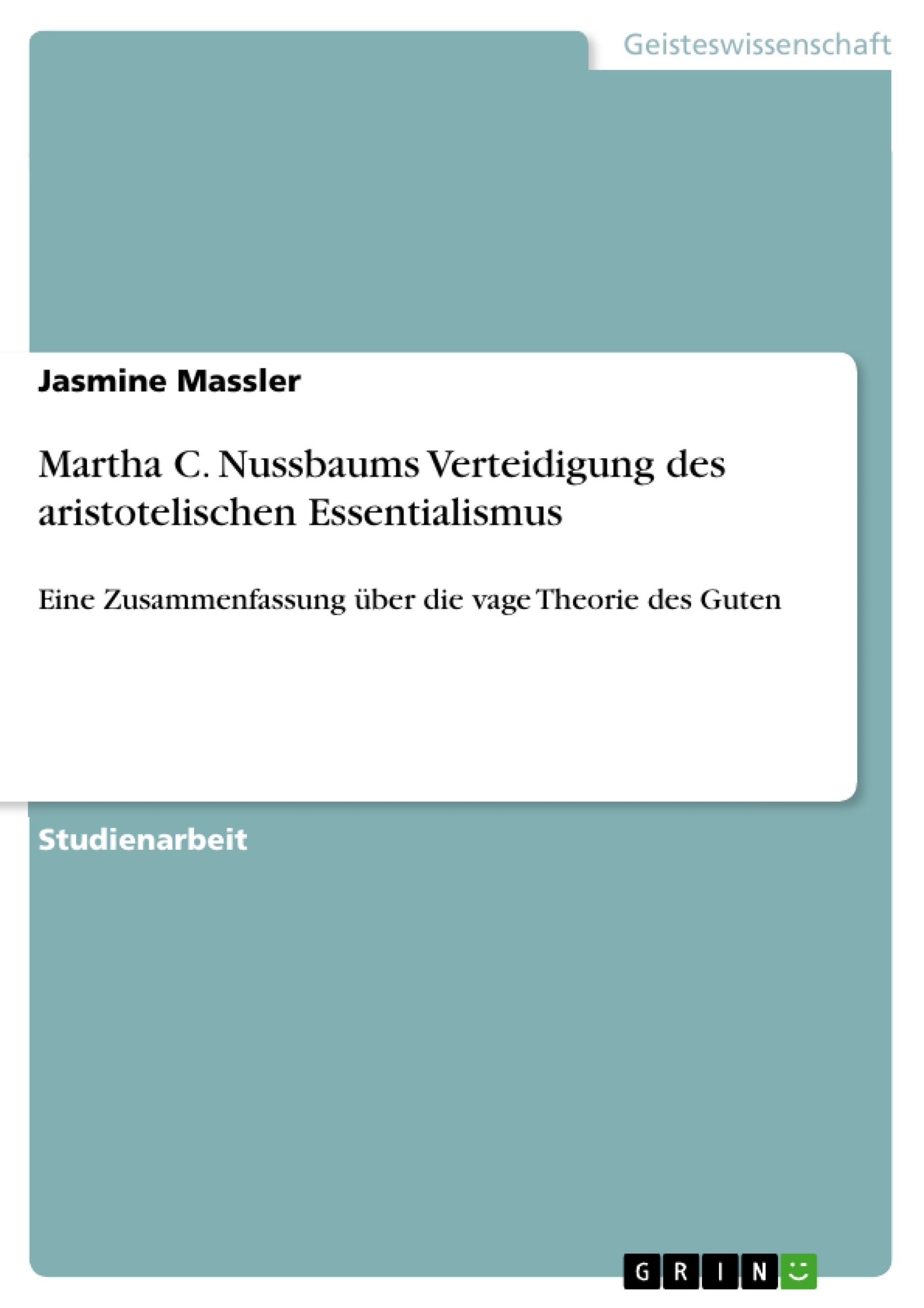Die vorliegende Arbeit basiert auf dem Text "Menschliches Tun und soziale Gerechtigkeit - Zur Verteidigung des aristotelischen Essentialismus" von M. C. Nussbaum.
Es werden die markanten Punkte ihrer Auffassung herausgearbeitet und erläutert. Anschließend erfolgt eine Gegenüberstellung mit dem Aufsatz "Selbstbejahung, Selbstreflexion und Sinnbedürfnis" von Holmer Steinfath, der einen subjektivistischen Standpunkt vertritt.
Es soll analysiert werden, ob essentialistische und subjektivistische Auffasungen tatsächlich unvereinbar miteinander sind, und ob M. C. Nussbaums "starke vage Theorie des Guten" ausreichend ist, um ein gutes Leben zu garantieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsdefinitionen, Problematik und Ziel des Textes
3. Nussbaums starke vage Theorie des Guten – Empirische Grundlage einer globalen Ethik
3.1. Die Grundlagen der starken vagen Theorie des Guten
3.2. Die beiden Ebenen der starken vagen Theorie des Guten
3.3. Mitleid und Achtung als basale Elemente der starken vagen Theorie des Guten – Kritik am Subjektivismus
3.4. Resümee über Nussbaums Konzeption
4. Die Auseinandersetzung des Essentialismus mit dem Subjektivismus
4.1. Holmer Steinfath – Ein Subjektivistischer Standpunkt
4.2. Moralischer Subjektivismus als Ergänzung zum Essentialismus?
5. Schluss
Literatur