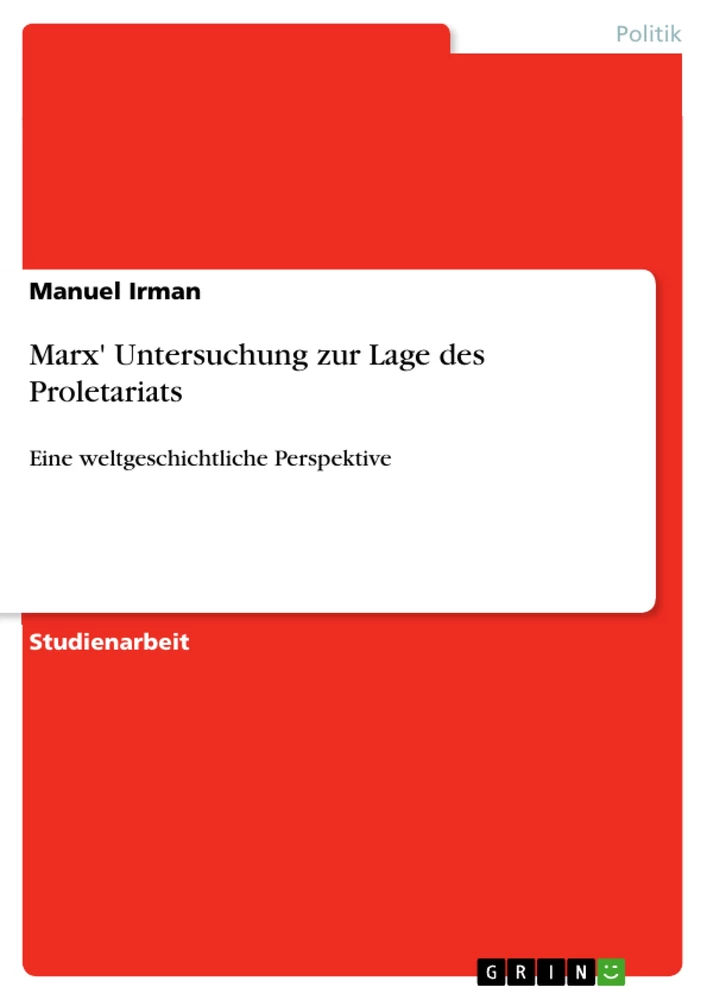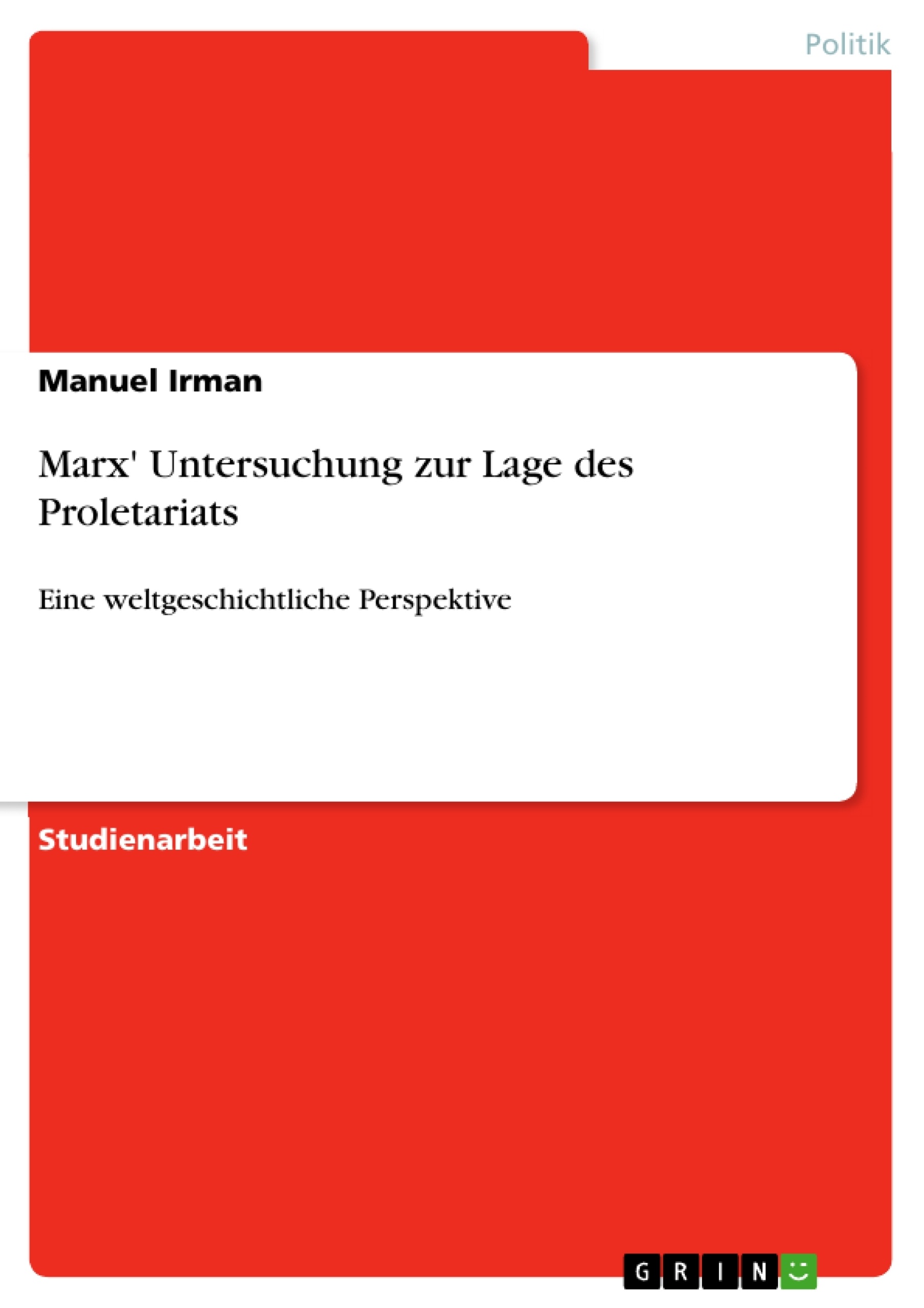In seiner ökonomischen Theorie deckt Karl Marx die Mechanismen auf, die zum gesellschaftlichen Missverhältnis - eine kleine, reiche Elite einerseits und die verarmte Masse andererseits - in den frühindustrialisierten Bevölkerungen führten. Obwohl Marx die Befreiung des einzelnen Proletariers ins Zentrum stellt, scheint diese nur zu gelingen, wenn sich die Arbeiterschaft über alle Grenzen hinweg zusammenschliesst. Die Gründe hierfür werden im vorliegenden Text untersucht und einige Parallelen zur gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Marx’ weltgeschichtliche Perspektive des Proletariats
2.1 Zentrale Begriffe der Marx’schen Theorie
2.2 Historischer Materialismus
2.3 Von der Geschichte zur Weltgeschichte
2.3.1 Individualisierung und Kommunismus
2.3.2 Globalisierung und Weltmarkt
2.4 Befreiung von den Ketten
2.5 Exkurs: Modernes globalisiertes Proletariat
3 Schlussfolgerungen
4 Bibliographie
4.1 Gedruckte Quellen
4.2 Internetressourcen
4.3 Sekundärliteratur
5 Anhang
5.1 Abkürzungsverzeichnis
5.2 Verzeichnis der einzelnen Texte in den Marx Engels Werken