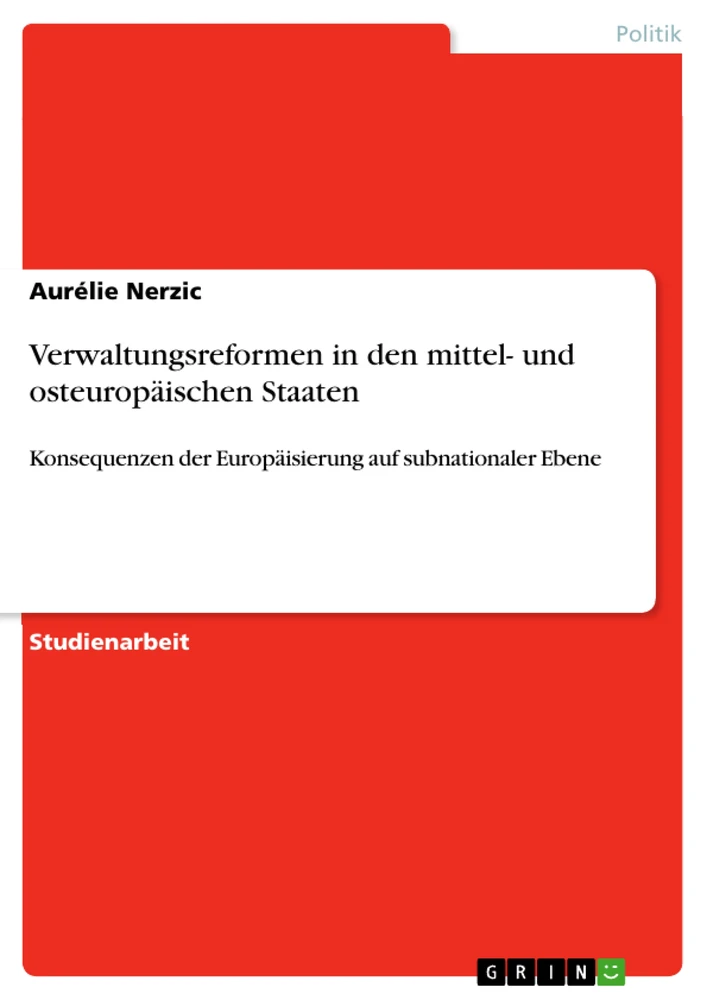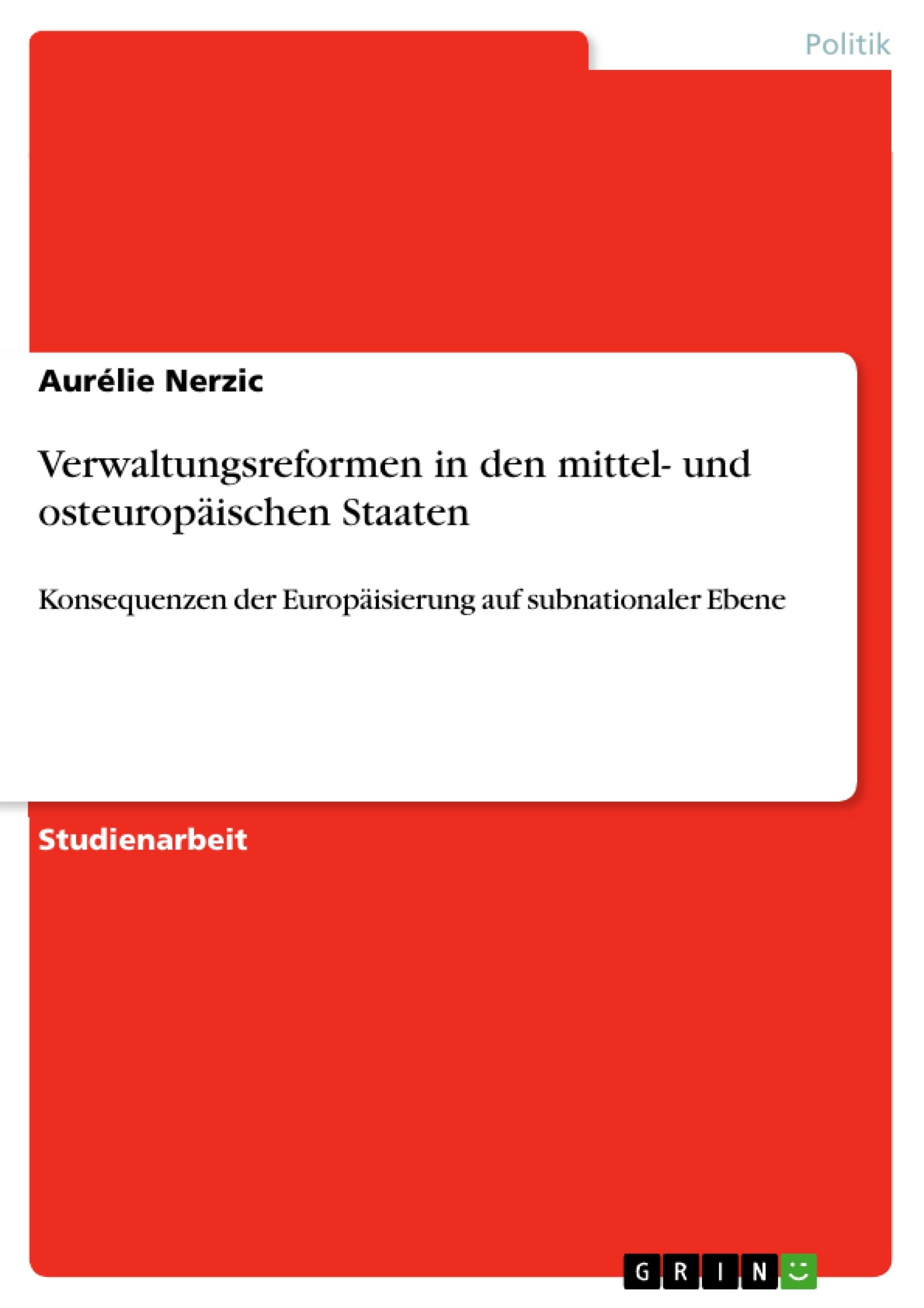Die Mittel- und osteuropäische Staaten sind durch ihren EU-Beitritt im Mittel der Forschungsdiskussionen, indem sie neue EU- Forschungsperspektiven durch ihre kulturelle, politische und geschichtliche Vergangenheit, die lange von der westeuropäischen abgetrennt worden ist, bringen können. In diesem Zusammenhang wollen wir diese Staaten mit der Forschungsthematik der Europäisierung zusammenbringen, die durch die ständige EU-Erweiterung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die mittel- und osteuropäische Staaten sind eigentlich der Auslöser der Theorie der Europäisierung, indem sie nach ihrer ehemaligen kommunistischen Vergangenheit versuchen, sich an die westeuropäische Modelle und Werte anzupassen. Man könnte fast von einer Westeuropäisierung der mittel- und osteuropäische Staaten sprechen.
Das Konzept der Europäisierung wird viel debattiert, weil er unter vielen Aspekten verstehen werden kann. Dennoch wollen wir in dieser Hausarbeit das Konzept der Europäisierung eher als eine EU-isierung verstehen. Es bedeutet also, dass wir uns hauptsächlich auf die Veränderungen in den mittel-und osteuropäische Staaten durch die Institution der EU konzentrieren werden. Die Theorie der Europäisierung ( oder hier EU-isierung) konzentriert sich in den Debatten meistens auf nationalstaatliche und zu selten auf subnationale Ebene. Dennoch spielt dieser letzte Aspekt eine große Rolle, weil sich die Europäisierung am deutlichsten auf die Regionalebene auswirkt. Das Ziel dieser Hausarbeit ist also aufzuzeigen, welcher Einfluss die EU auf die mittel- und osteuropäische Staaten übt, im Besonderen auf die subnationale Ebene dieser Staaten und zu welchen Verwaltungsreformen der EU-Beitritt geführt hat. Wir wollen untersuchen, ob dieser Einfluss völlig ist, oder sich nur auf manche Aspekte beschränkt.
Um dies am besten zu veranschaulichen, wollen wir zuerst die Konzepte der Europäisierung durch drei verschiedene Erklärungsprogramme und der Regionalpolitik der EU erklären. Danach können wir die Verwaltungsreformen in den mittel- und osteuropäische Staaten analysieren, indem wir zuerst auf die verschiedenen Formen der Regionalisierung, dann auf die spezifische Regionalisierungsform dieser Staaten und endlich auf ihre Konsequenzen eingehen. In dieser Hausarbeit werden die mittel- und osteuropäische Staaten mit den Buchstaben MOE abgekürzt. Die MOE- Staaten umfassen hier die folgenden Staaten: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Polen.
INHALTSVERZEICHNIS
I- Einführung
II- Die Konzepte der Europäisierung und der Regionalpolitik der EU
1- Erklärungsprogramme zur Europäisierung
1.1 Das rationale Erklärungsprogramm
1.2 Das konstruktivistisch geprägte Erklärungsprogramm
1.3 Das Policy-analystische Programm
2- Die Regionalpolitik der EU
III- Verwaltungsreformen in den MOE- Staaten: Entwicklung und Konsequenzen
1- Die verschiedenen Formen der Regionalisierung
2- Die Regionalisierung in den MOE- Staaten
3- Konsequenzen der Regionalisierung in den MOE –Staaten .
IV- Schluss
V- Quellen
Tabelle 1
Tabelle 2