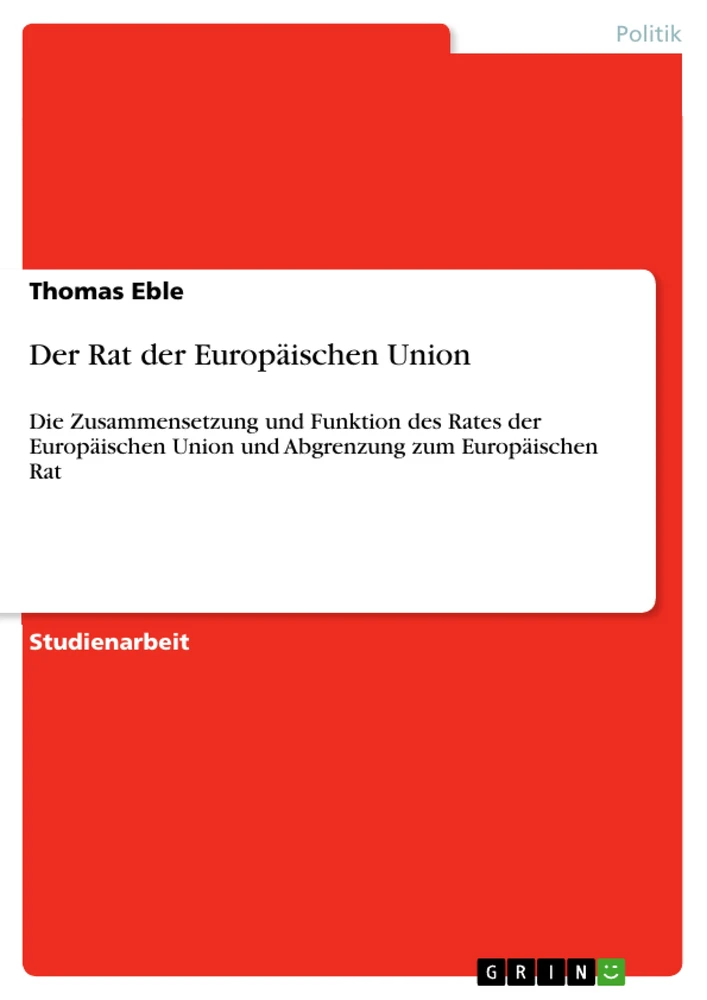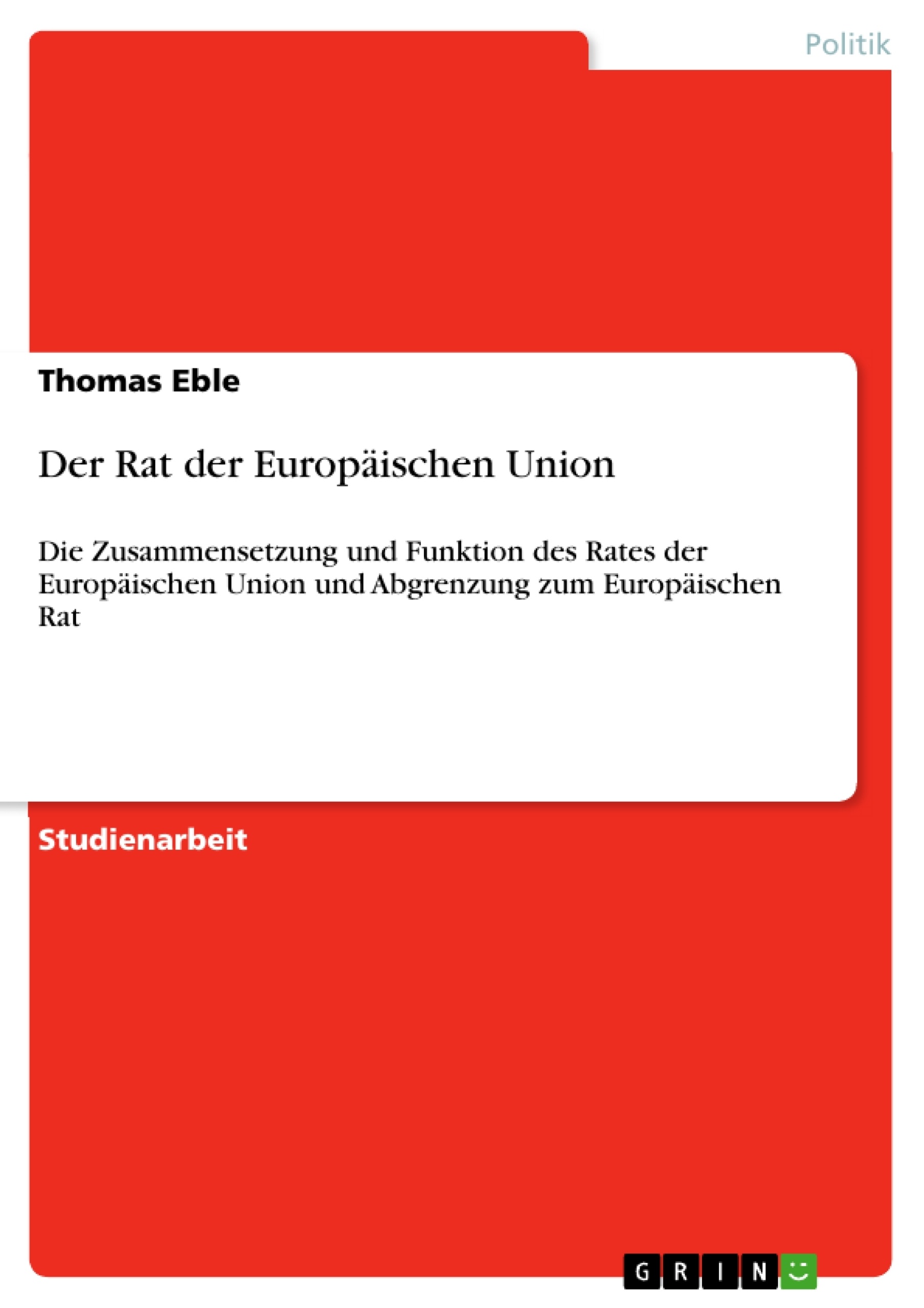Seit den Gründungsjahren der Europäischen Union, hat sich das vertragliche Gerüst, auf dem sich der Staatenbund aufbaut stetig weiterentwickelt. Der Rat der Europäischen Union wurde bereits 1951, durch die Unterzeichnung des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), als das zweite von vier Organen geschaffen. Er zählt, neben der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parla-ment, zu den Leitungsorganen der Union und nimmt auch unter diesen eine herausragende Stellung ein. Über zahlreiche vertragliche Veränderungen gewann der Rat der Europäi-schen Union über die Jahre immer mehr an politischer Bedeutung. Mit dem Wachstum der Union in den letzten Jahren wurden somit auch die Zuständigkeiten und Aufgaben des Rates ständig erweitert. So rückte der Rat vor allem in den letzten 15 Jahren immer stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Gleichzeitig hat der Rat aber auch – wie jedes poli-tische Entscheidungsgremium – äußerst komplizierte formelle Strukturen entwickelt.
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, genau diese komplexen Strukturen zu beleuchten und näher zu betrachten. Es soll sowohl ein Überblick über die Zusammensetzung des Rates als auch eine genauere Betrachtung und Abgrenzung des Rates im Bezug auf die andere Organe und vor allem den „Europäischen Rat“ stattfinden.
Hierzu soll der Rat der EU zuerst im politischen System der Union eingeordnet werden und anschließend im Detail erklärt werden. Auch die Aufgaben und Kompetenzen des Rates werden dabei kurz erläutert. Besonders herausgearbeitet werden soll im Anschluss die Unterscheidung zum „Europäischen Rat“, der zwar politisch eng mit dem Rat der EU verflochten ist, aber rechtlich nicht als Organ der EU betrachtet wird.
2. Zum Rat der Europäischen Union
„Der Rat der Europäischen Union repräsentiert die Vertretung der Mitgliedstaaten im politischen System der EU“ . Er ist – im Gegensatz zur Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament – ein Organ, in dem laut Vertrag ausschließlich mitgliedstaatliche Vertreter sitzen. Demnach sollen im Rat der EU auch hauptsächlich mitgliedstaatliche Interessen wahrgenommen werden . Aufgrund seiner formellen Kompe-tenzen wird der Rat der Europäischen Union auch als das wichtigste Organ der EU be-zeichnet .
Häufig findet man anstatt der Bezeichnung „Rat der Europäischen Union“ auch die synonymen Bezeichnung „(EU-) Ministerrat“ oder nur “der Rat“, welche oft zu Verwechslungen führen .
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Thematik der Arbeit
1.1. Einführung
1.2. Zielsetzung und Aufbau
2. Zum Rat der Europäischen Union
2.1. Einordnung im politischen System der EU
2.2. Institutionelle Struktur des Rates
2.2.1. die verschiedenen Ratsformationen
2.2.2. Ratspräsidentschaft
2.2.3. Ausschuss der Ständigen Vertreter
2.3. Aufgaben und Kompetenzen des Rates
3. Die Rolle des Europäischen Rates
3.1. Abgrenzung zum Rat der Europäischen Union
3.2. Entstehung und Zusammensetzung des Europäischen Rates
3.3. Funktion und Aufgaben des Europäischen Rates
4. Schlussbetrachtung
Quellenverzeichnis