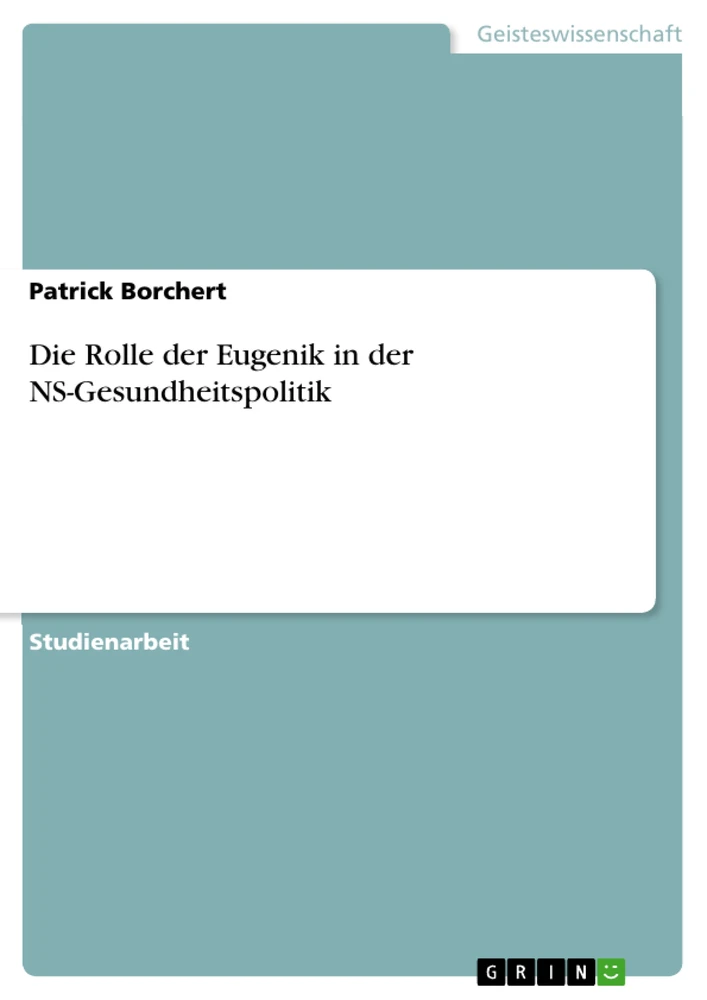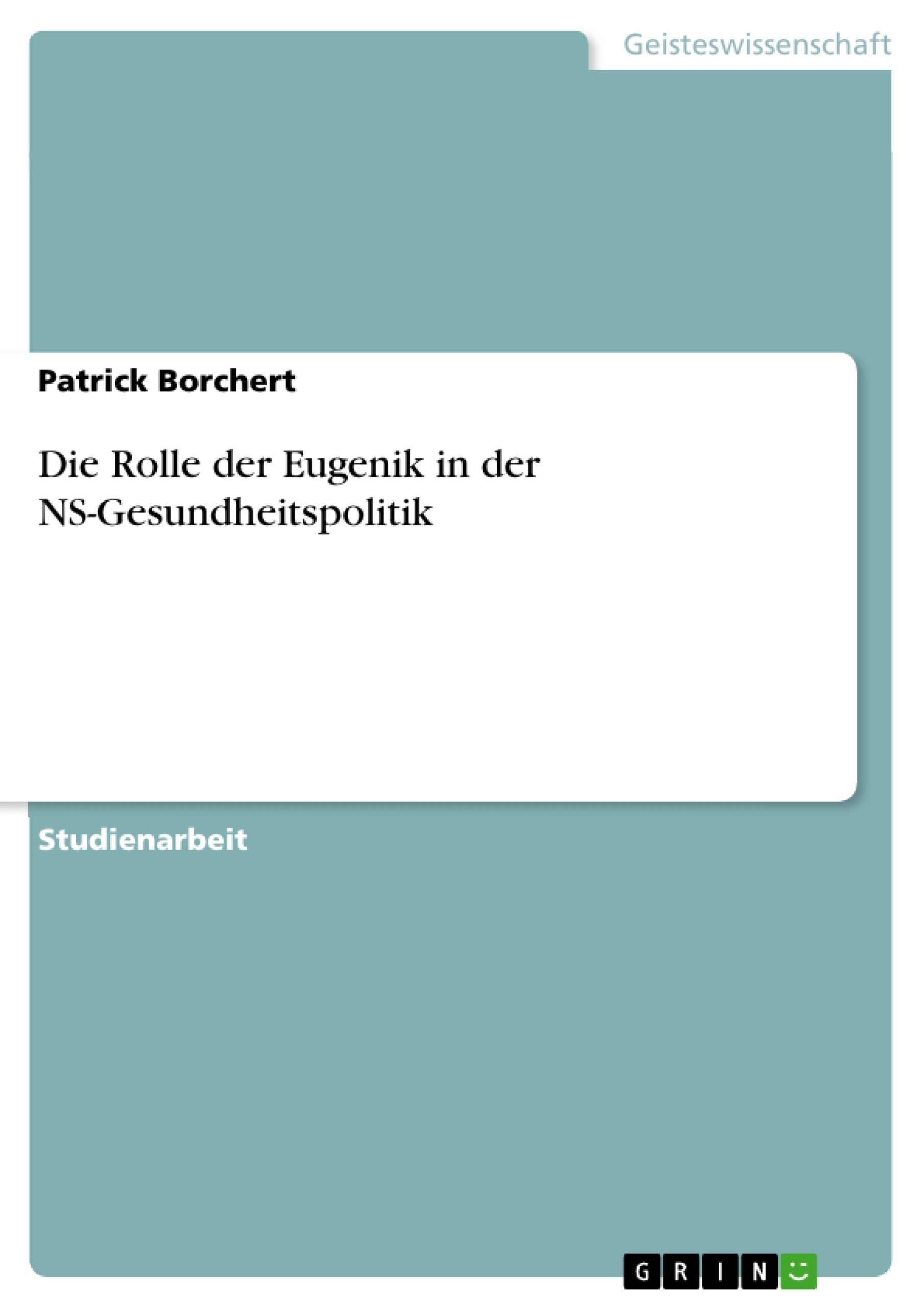Die Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 gilt als einer der am besten erforschten Zeitabschnitte in der deutschen Geschichte. Nicht nur die Geschichtswissenschaft selbst als primäre Forschungsdisziplin, sondern auch alle anderen (angrenzenden) Wissenschaftsgebiete befassen sich zum einen nach Maßgaben ihrer jeweiligen Forschungsrichtung mit ausgewählten Aspekten aus dieser Zeit und zum anderen kritisch reflektierend mit ihrer jeweiligen Rolle im Dritten Reich.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Annäherung an den Begriff Eugenik
2.1 Was ist Eugenik?
2.2 Historisch-biologische Grundlagen
3. Eugenik im Deutschen Reich vor
3.1 Die Etablierung rassenhygienischer Gedanken vor
3.2 Eugenik in der Weimarer Republik
4. Eugenik im Nationalsozialismus
4.1 Ideologische Prämissen und NS-Gesundheitspolitik
4.2 Die Realisierung eugenischer Maßnahmen im NS-Staat
5. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis.