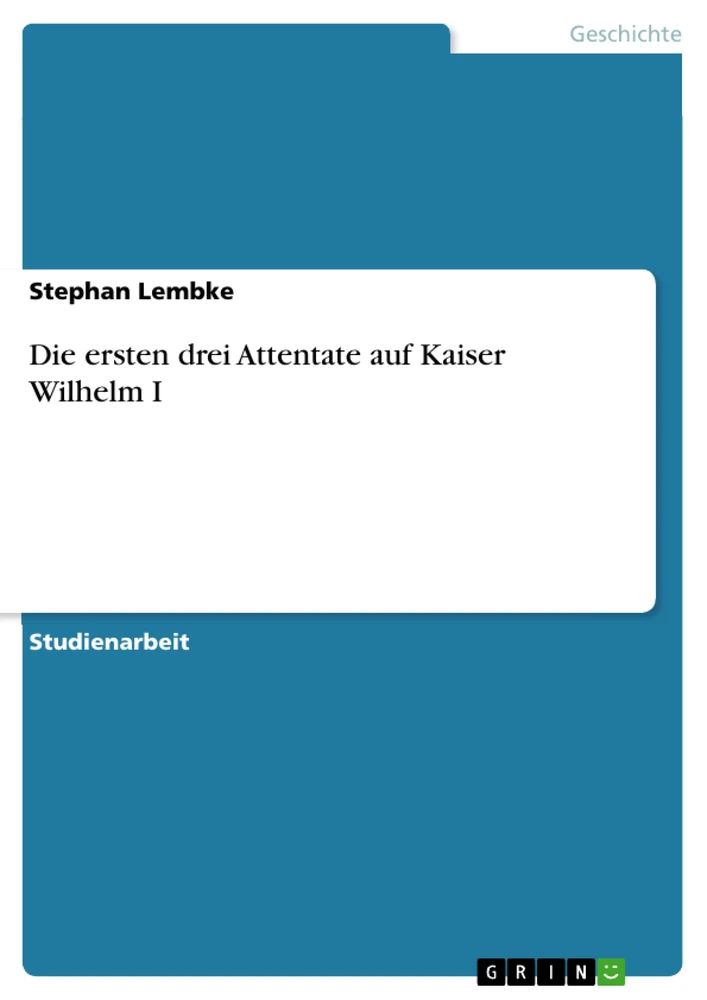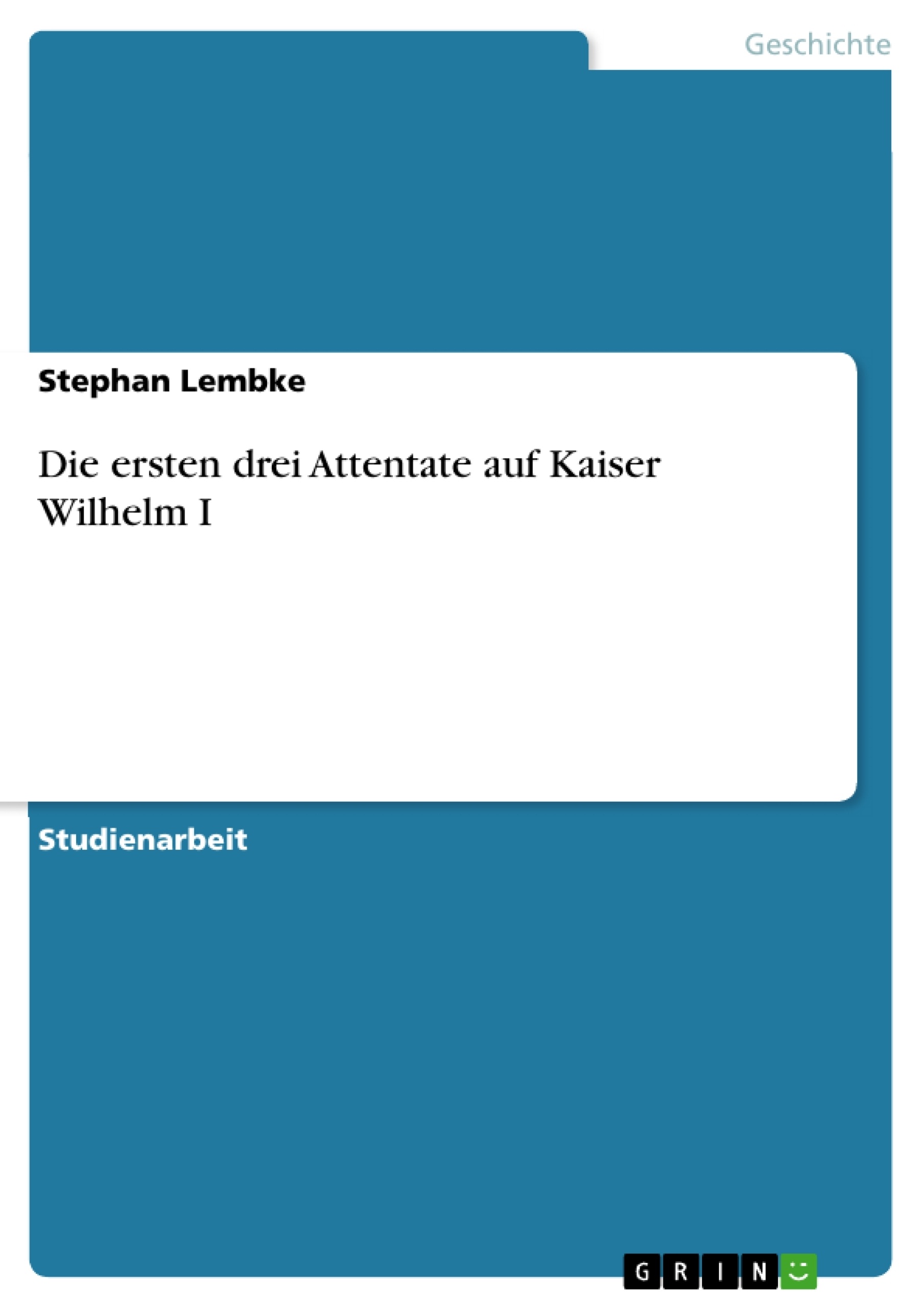Fast täglich liest man in der Zeitung oder sieht in den Nachrichten Meldungen über verübte Anschläge in der Welt. Viele dieser Anschläge berühren die Zuschauer und Leser dabei nicht besonders, sondern sie nehmen sie als irreales Ereignis teilnahmslos hin, ohne persönlich betroffen zu sein. Größere Anteilnahme wird von der Masse bekundet, wenn es Anschläge auf berühmte Personen sind, zu denen sie einen Bezug haben.
In solchen Fällen spricht man von Attentaten. Ein Attentat ist ein Anschlag auf eine Persönlichkeit von hohem politischen, religiösen oder gesellschaftlichen Rang, welche der Attentäter versucht zu töten oder zu verletzten. Auch Anschläge auf bekannte Gebäude werden als Attentat gesehen.
Eine solche Tat muss von einer politischen Hinrichtung unterschieden werden. Eine politische Hinrichtung ist von staatlichen Organen veranlasst und somit im Gegensatz zu einem Attentat nicht illegal wo hingegen ein Attentat verübt von einem Täter oder einer Tätergruppe meist illegal ist. In seltenen Fällen lassen sich politische Attentate gesetzlich legitimieren. Sogar heute noch ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland im Artikel 20, dem sogenannten Widerstandsgesetz, festgehalten, wann Widerstand gegen die Obrigkeit gesetzlich erlaubt ist.
Artikel 20
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtssprechungen ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an das Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Somit scheint der sogenannte Tyrannenmord in wenigen Fällen vom Gesetz her in Deutschland legitimiert. Schwierig gestaltet sich dabei die Interpretation des Gesetzes, da ein Ausschöpfen der Möglichkeiten und die Wahl der Mittel für den politischen Widerstand definitorisch unscharf sind. Eine Chance, sich für eine Rechtfertigung eines Attentats auf dieses Gesetz zu beziehen, scheint als sehr unwahrscheinlich.
[...]
Inhaltsangabe
1. Einleitung
2. Das Opfer: Kaiser Wilhelm I.
3. Die ersten drei Attentate
3.1. Das erste Attentat am 14. Juli 1861
3.1.1. Der Täter
3.1.2. Die Tat
3.1.3. Das Motiv
3.2. Das zweite Attentat am 11. Mai 1878
3.2.1. Der Täter
3.2.2. Die Tat
3.2.3. Das Motiv
3.3. Das dritte Attentat am 2. Juni 1878
3.3.1. Der Täter
3.3.2. Die Tat
3.3.3. Das Motiv
3.4. Politische Auswirkungen der Attentate 1878
4. Fazit
5. Literaturliste