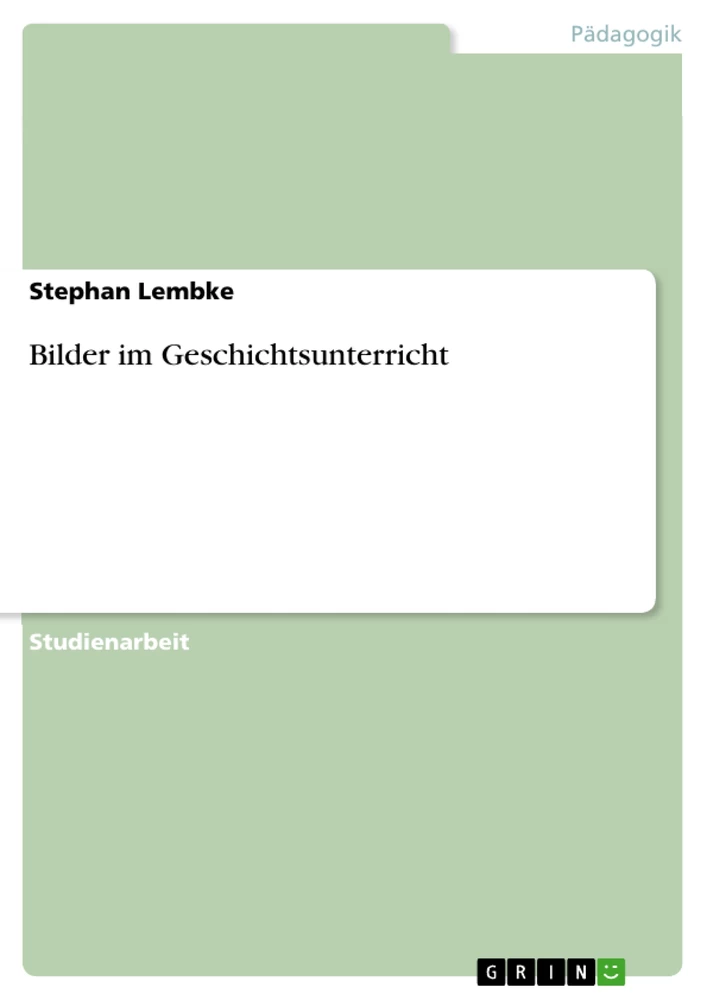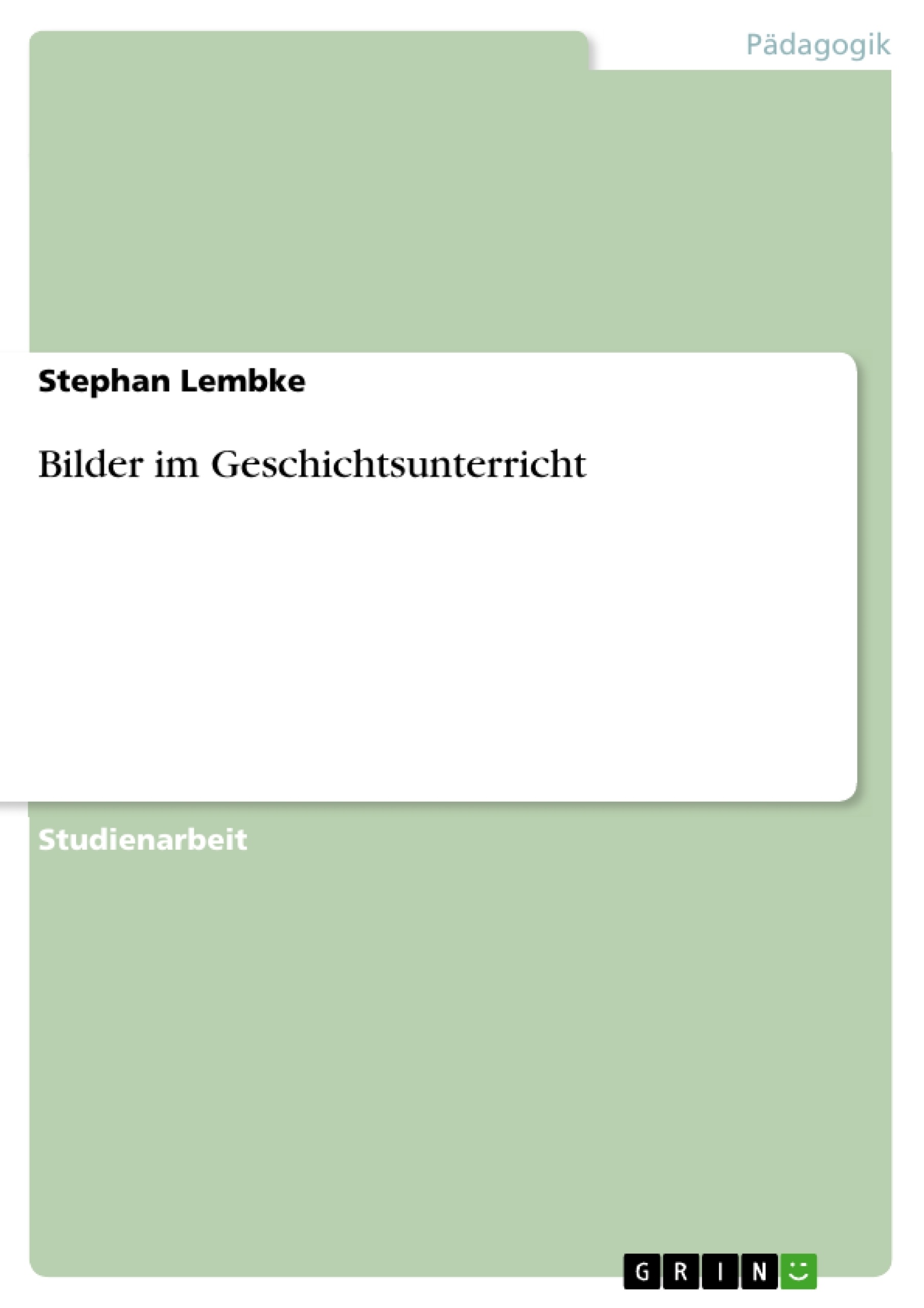Im heutigen Zeitalter der Kommunikation und durch die vielfältigen Möglichkeiten der Verbreitung mit verschiedensten Medienformen hat das Bild eine enorme Bedeutung in unserer Gesellschaft. Bilder vermögen es durch ihre subjektive Aussagekraft die Gesellschaft zu beeinflussen und dienen dadurch nicht selten als meinungsbildender Gegenstand, der als solcher auch missbraucht werden kann. Gleichwohl ob Fernsehen, Tageszeitung oder sonstige Print- und Filmmedien, das Bild ist zu einem ständigen Begleiter unseres Alltags geworden und nicht selten findet eine visuelle Überreizung durch diese statt.
Auch im Bereich der Geschichtswissenschaft hat das Medium Bild einen neuen Stellenwert erlangt und ist auf diesem Wege zu einer festen Größe im Geschichtsunterricht aller Schultypen und Altersklassen geworden. Zwar gilt das Bild im Geschichtsunterricht neben der Tafel und dem Lehrbuch als eines der ältesten Materialien, dennoch hat sich gerade in den letzten Jahren ihr Einsatz grundlegend gewandelt. Dies wird nicht zuletzt anhand einer steigenden Zahl von „Literatur zur Frage eines zeitgemäßen Einsatzes und Gebrauchs von Bildern im Geschichtsunterricht“ deutlich. Allerdings finden Bilder hierbei überwiegend noch als Illustration Einzug in den Unterricht. In diesem Fall ist ihr didaktischer Nutzen hauptsächlich auf eine attraktive, anschauliche und konkrete Darbietung von Geschichte beschränkt. Sie sollen „affektiv ansprechen, die Aufmerksamkeit der Schüler stärken, zur [...] Verlebendigung abstrakter oder unbekannter Sachverhalte beitragen, Betroffenheit bei den Betrachtern auslösen und den Lernerfolg sichern.“ Die vielfältigen didaktischen Möglichkeiten die über diese Illustration hinaus bestehen, werden aber weiterhin nur spärlich ausgeschöpft. Bilder werden also im Geschichtsunterricht längst nicht mit der Selbstverständlichkeit als historische Quellen betrachtet und behandelt, wie es bei Textquellen gegeben ist. Eine systematische Beschäftigung stellt nach wie vor die Ausnahme dar. Dies steht letztlich auch im Widerspruch zur üppigen Ausstattung der Schulbücher mit farbigen Bildern, die den Eindruck erwecken, das Bild sei zu einem zentralen Medium des Geschichtsunterrichts geworden. Nach einem kurzen Überblick über die Möglichkeiten und einer Betrachtung verschiedener Ansätze zur Bearbeitung von Bildern als Quelle im Geschichtsunterricht sollen in dieser Arbeit Möglichkeiten und didaktische Potentiale von Bildern für den Geschichtsunterricht aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Die Bedeutung von Bildern für die Geschichtswissenschaft
3. Zur Geschichte des Bildes im Geschichtsunterricht
4. Definition und Gattungen bildlicher Unterrichtsmittel
4.1. Definition: Was ist ein Bild?
4.2. Bilderarten und Einteilungen
4.3. Gattungen der bildlichen Unterrichtsmittel nach Gies
4.3.1. Historische Abbildungen
4.3.2. Graphisch-didaktische Abbildungen
4.3.3. Geschichtskarten
5. Verwendung von Bildern im Geschichtsunterricht
5.1. Warum Bilder im Geschichtsunterricht? Was können sie vermitteln?
5.2. Kriterien für die Bildinterpretation nach Panowsky und Pandel
5.3. Handlungsorientierter Umgang mit Bildern im Geschichtsunterricht
6. Kritik an Bildquellen in Geschichtsbüchern
7. Fazit
8. Literaturverzeichnis