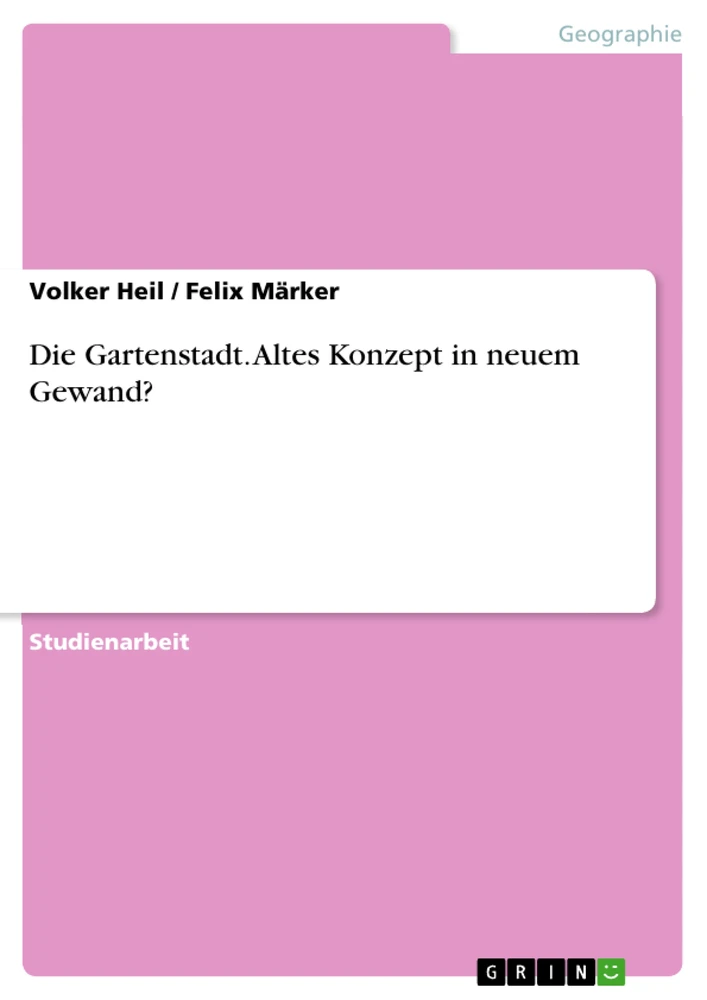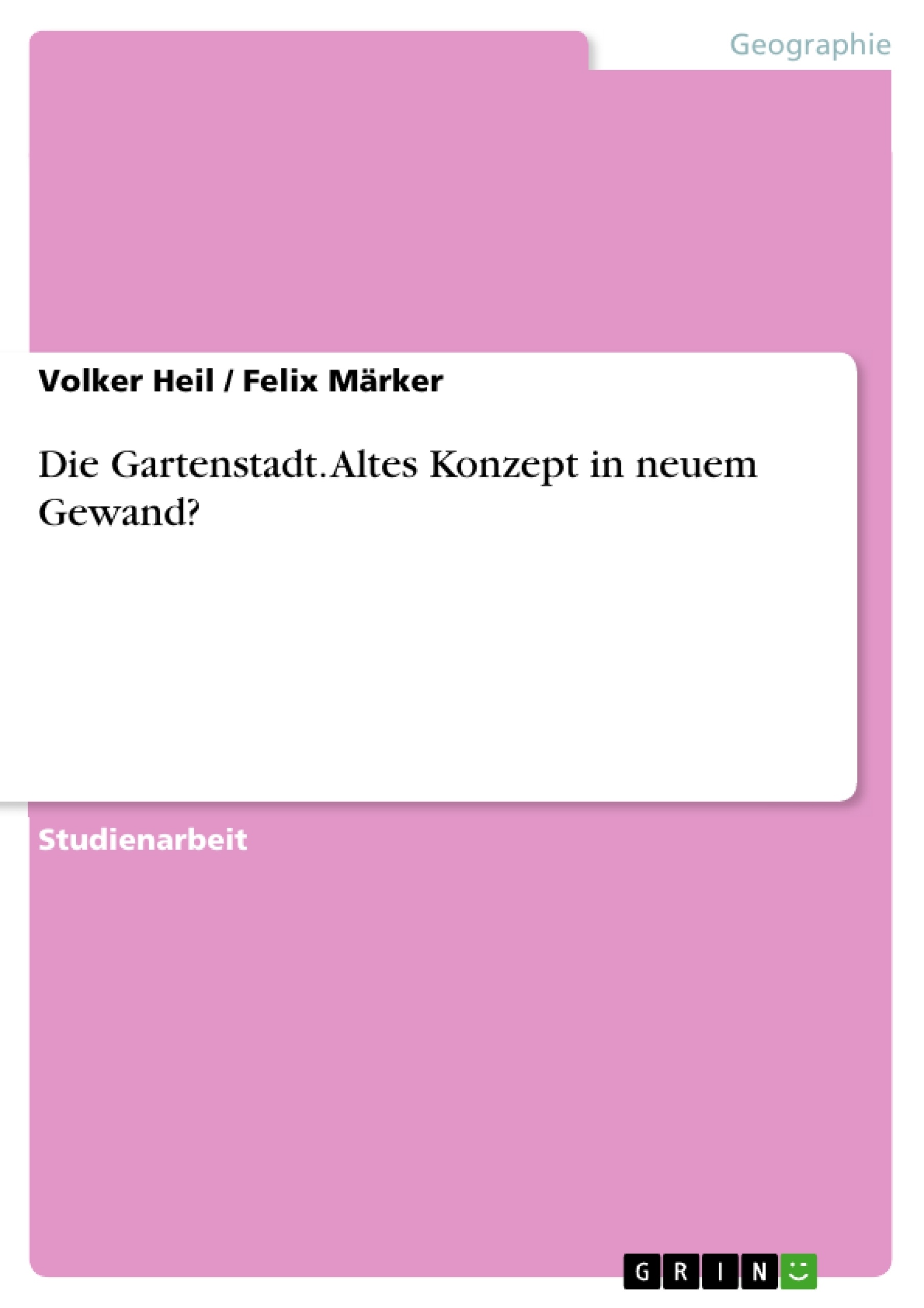Diese Arbeit befasst sich mit dem Stadtentwicklungsmodell der Gartenstadt von Ebenezer Howard in Vergangenheit und Gegenwart.
Nach einer historischen Einführung in das Thema wird die heutige Situation anhand eines Beispieles dargestellt und in einem abschließenden Vergleich untersucht, was aktuelle Planungen von Howards Modell unterscheiden und was von den ursprünglich angedachten
Strukturen übrig geblieben ist.
Als Basis zum Erreichen der Zielsetzung, dem Vergleich von Howards Gartenstadt mit neuen Entwicklungen, stand eine gründliche Analyse der Geschichte der Gartenstadt sowie den aktuellen Planungsansätzen. Hierzu bildete die Bearbeitung wissenschaftlicher Literatur zu der jeweiligen Thematik die theoretische Grundlage der Arbeit.
Für den „Forschungsteil“ dieser Arbeit, dem Vergleich der Planungsansätze in Kapitel 4, wurden Bewertungskriterien definiert anhand welcher die drei Planungsansätze (Howards Modell, historische Gartenstadt Essen-Margarethenhöhe und Seseke Aue in Kamen als "Neue Gartenstadt") systematisch miteinander verglichen wurden. Diese ergaben sich aus der vorhergehenden Analyse der verschiedenen Konzepte und sollen einen anschaulichen Vergleich ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Zielsetzung
1.2 Methodik
1.3 Aufbau
2. Entwicklung der Gartenstadt
2.1 Rahmenbedingungen, Howards Modell und die ersten Gartenstädte
2.1.1 Historischer Kontext
2.1.2 Leitziele und Struktur
2.1.3 Umsetzung des Modells
2.2 Die Gartenstadtbewegung in Deutschland
2.2.1 Historische Situation und die Deutsche Gartenstadtgesellschaft
2.2.2 Beispiel einer Gartenstadt im Ruhrgebiet, Essen-Margarethenhöhe
2.3 Zwischenfazit
3. Die Gartenstadt heute – Aktuelle Entwicklung am Beispiel Seseke Aue, Kamen
3.1 Rahmenbedingungen Emscher-Region
3.1.1 Siedlungsentwicklung
3.1.2 Bevölkerung
3.1.3 IBA Emscher Park
3.2 Gartenstadt Seseke Aue, Kamen
4. Vergleich der Planungsansätze
4.1 Bewertungskriterien
4.2 Gegenüberstellungen der Planungsansätze
4.3 Auswertung
5. Fazit
Literaturverzeichnis