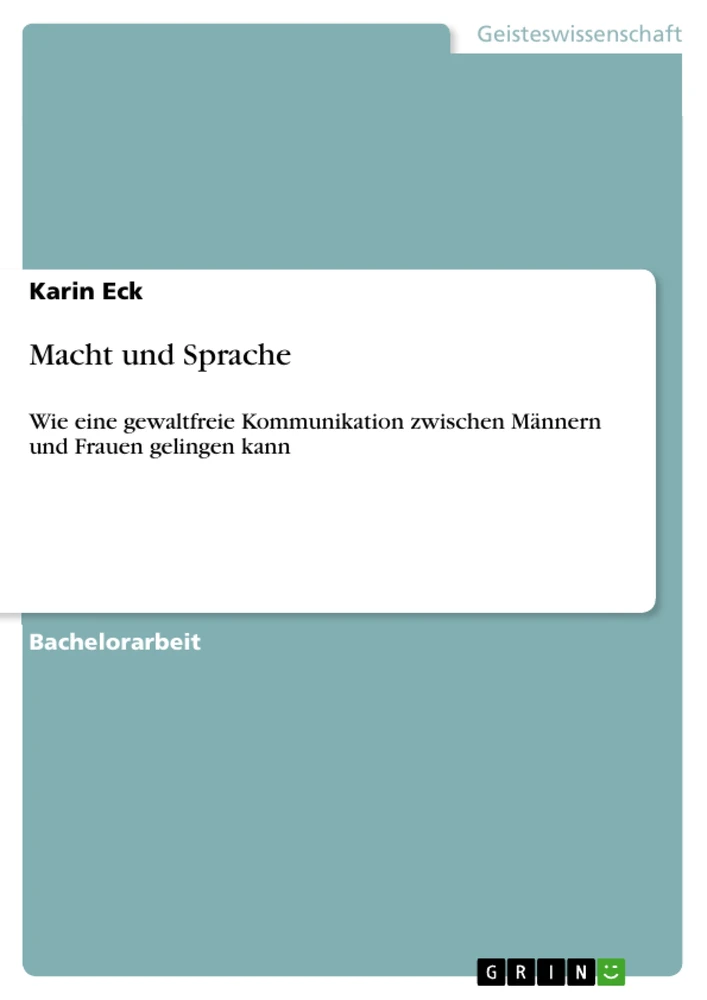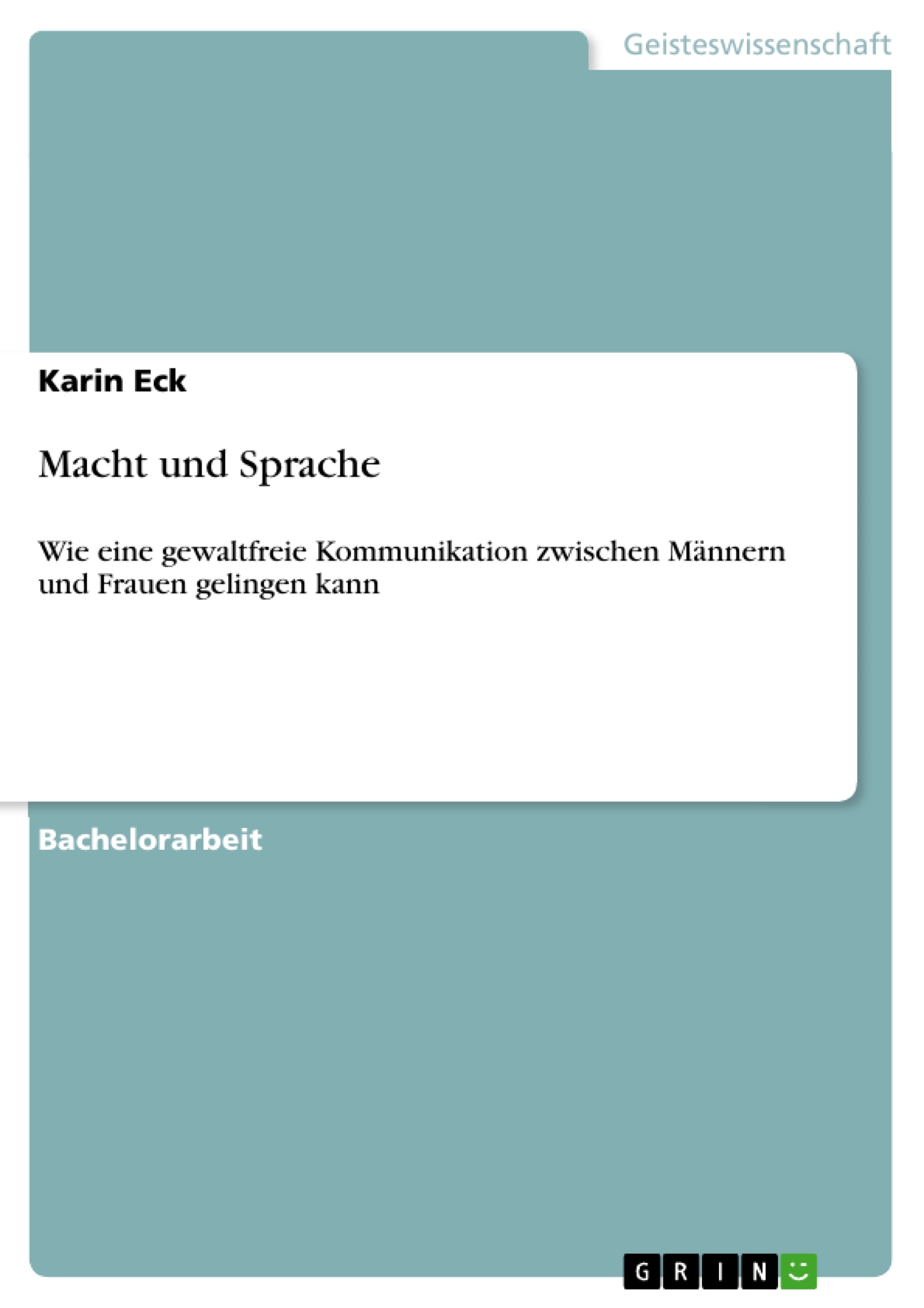Die Anregung für das Thema der vorliegenden Bakkalaureatsarbeit bekam ich durch die
Vorlesungsübung „Geschlechterforschung“ im Sommersemester 2005. In dieser VU wurde
das Thema Gewalt und Sprache umrissen. Dieses Thema ließ mich aufhorchen und mein
Interesse daran war geweckt. Ich habe schon oft beobachtet, wie in der Kommunikation
nachlässig und unbewusst mit Worten umgegangen wird. Es werden vielleicht Dinge gesagt,
die nicht so gemeint waren. Worte können Menschen aufbauen, ermutigen und verändern,
aber sie können auch erniedrigen, verletzen, entmutigen oder Menschen zerstören. Dies
geschieht durch Sprache und kann verbal, aber auch nonverbal, durch unsere Gesten oder
Mimik, geschehen. Wie sieht nun Sprache zwischen den Geschlechtern aus? Im Umgang
mit dem anderen - manchmal vielleicht unbekannten – Geschlecht kann es sehr schnell zu
Vorurteilen und Missverständnissen kommen. Mit dieser Arbeit möchte ich eine Sensibilität
für Sprache wecken; die Arbeit bot für mich auch die Gelegenheit, neu über
Machtverhältnisse in der Kommunikation zwischen den Geschlechtern und die Auswirkungen
auf die Gesellschaft nachzudenken und das Bearbeitete zu reflektieren. Durch die intensive
Beschäftigung mit dem Thema Macht und Sprache habe ich mein Bewusstsein in diesem
Bereich erweitern können, so dass ich die Kommunikation in gemischtgeschlechtlichen
Gruppen heute mit anderen Augen sehe. Ich möchte den Leser/die Leserin einladen, sich
auf die Reise in das Land der Sprache der Geschlechter einzulassen.[...]
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Einleitung
2. Sprache und Geschlecht - die linguistische Genderforschung
2.1 Die linguistische Genderforschung in der Wissenschaft
2.1.1 Sprachkritischer Ansatz
2.1.2 Erforschung des Gesprächsverhaltens von Männern und Frauen
3. Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Kommunikation
3.1 Was ist Kommunikation?
3.2 Männer- und frauentypische Kommunikation
3.2.1 „ Typisch “ männlich
3.2.2 „ Typisch “ weiblich
4. Macht und Sprache - wie drückt sich Macht in der Kommunikation aus?
4.1 Macht in der verbalen Kommunikation
4.2 Nonverbale Kommunikation
5. Möglichkeiten zu einer Veränderung der Kommunikation
5.1 Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg
5.1.1 Lebensentfremdende Kommunikation
5.1.2 Das Modell der Gewaltfreien Kommunikation
6. Gewaltfrei kommunizieren - Chancen und Grenzen der Gewaltfreien Kommunikation
6.1 Empathie
6.2 Bedürfnisse
6.3 Grenzen der Gewaltfreien Kommunikation
7. Resümee - Ausblick
8. Literaturverzeichnis