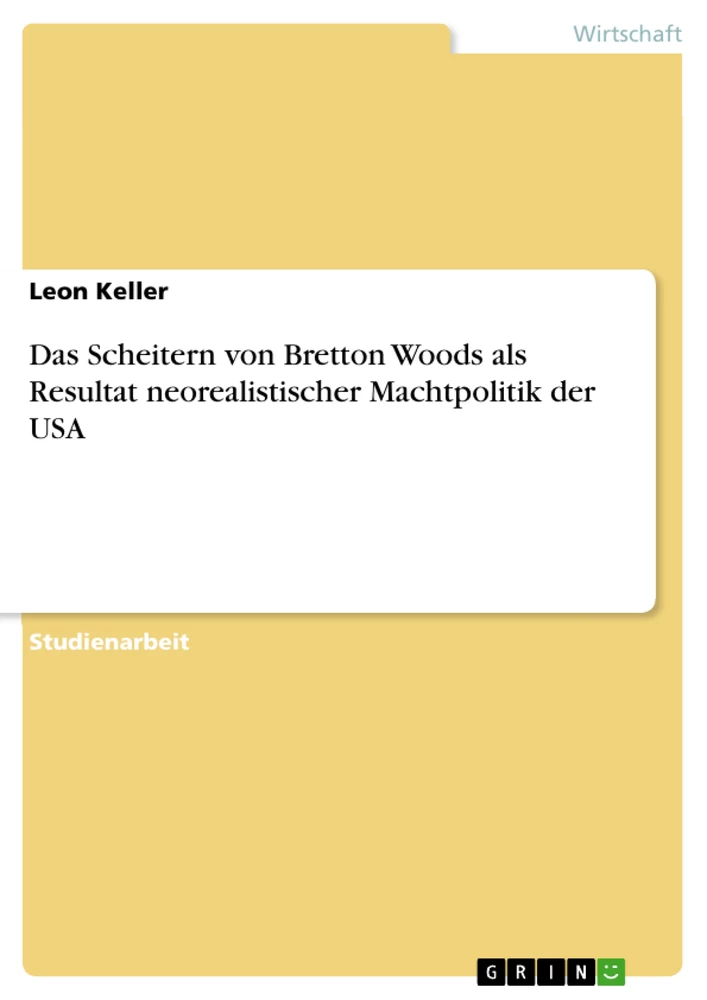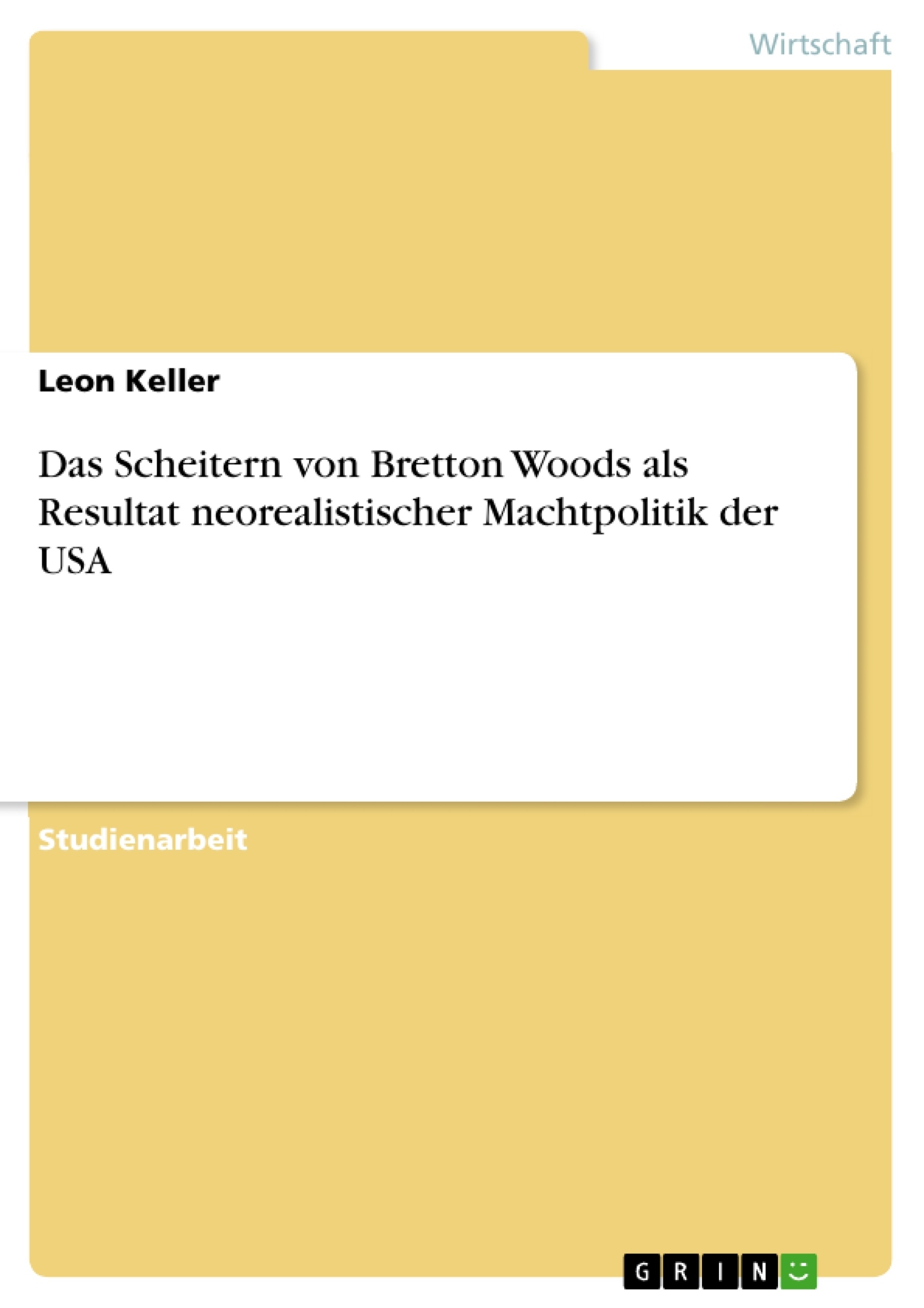Das Abkommen über die Gründung des Internationalen Währungsfonds (IWF), das 1944 unterzeichnet wurde, stellt die Geburtsstunde des Bretton-Woods-Systems dar. Mit einem internationalen Währungssystem das auf festen Wechselkursen beruhte, wollte man die katastrophalen wirtschaftlichen Entwicklungen der Zwischenkriegszeit vermeiden. Bereits 27 Jahre später galt das System als gescheitert, die festen Wechselkurse und die Bindungen aller teilnehmenden Währungen am US-Dollar wurden aufgehoben, flexible Wechselkurse bestimmen heute das internationale Währungssystem. Die USA hatten in dem Währungsregime eine besondere Rolle inne, auf deren Einzelheiten hier eingegangen werden soll. Sicher ist jedoch, dass die USA mit ihrem Alleinstellungsmerkmalen die Möglichkeit nutzten, das System scheitern zu lassen indem US-Präsident Nixon im August 1971 die Bindung des US-Dollar an den Goldstandard aufhob. Die Frage nach den Gründen des Niedergangs und der Verantwortung der USA drängen sich hier auf. In dieser Hausarbeit soll vor allem der Frage nachgegangen werden, ob das Scheitern von Bretton Woods ein Resultat neorealistischer Machtpolitik der USA ist. In dieser Arbeit verzichte ich auf eine detaillierte Darstellung der neorealistischen Theorie.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Das Bretton-Woods-Regime und die besondere Rolle der USA
1.2 Neorealistisch determinierte Entscheidungen der Nixon-Administration
1.3 Fazit