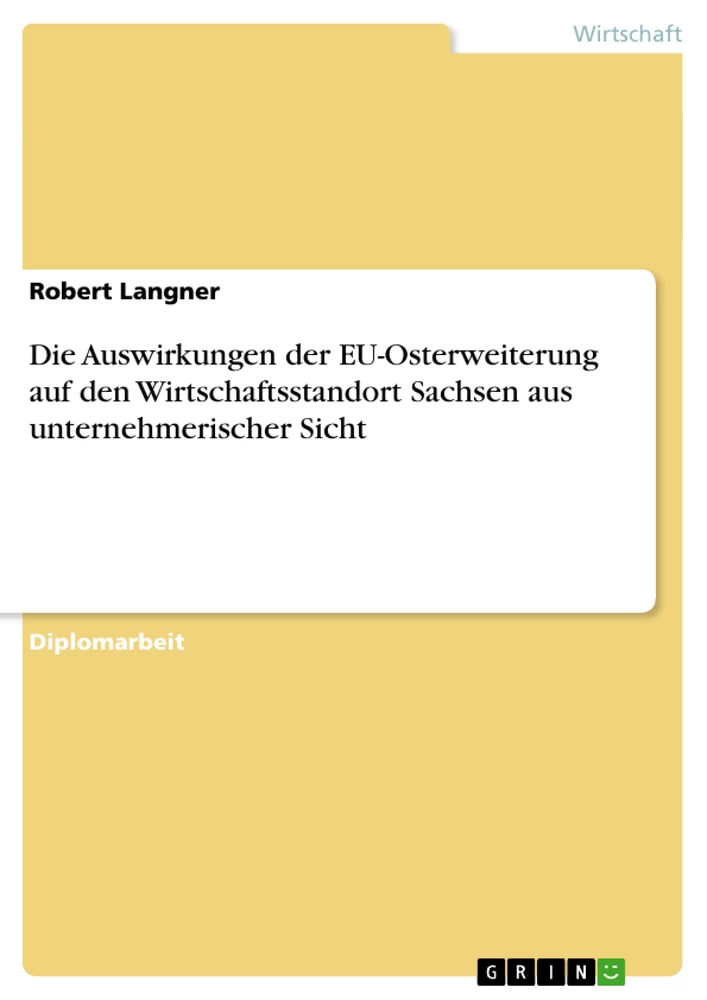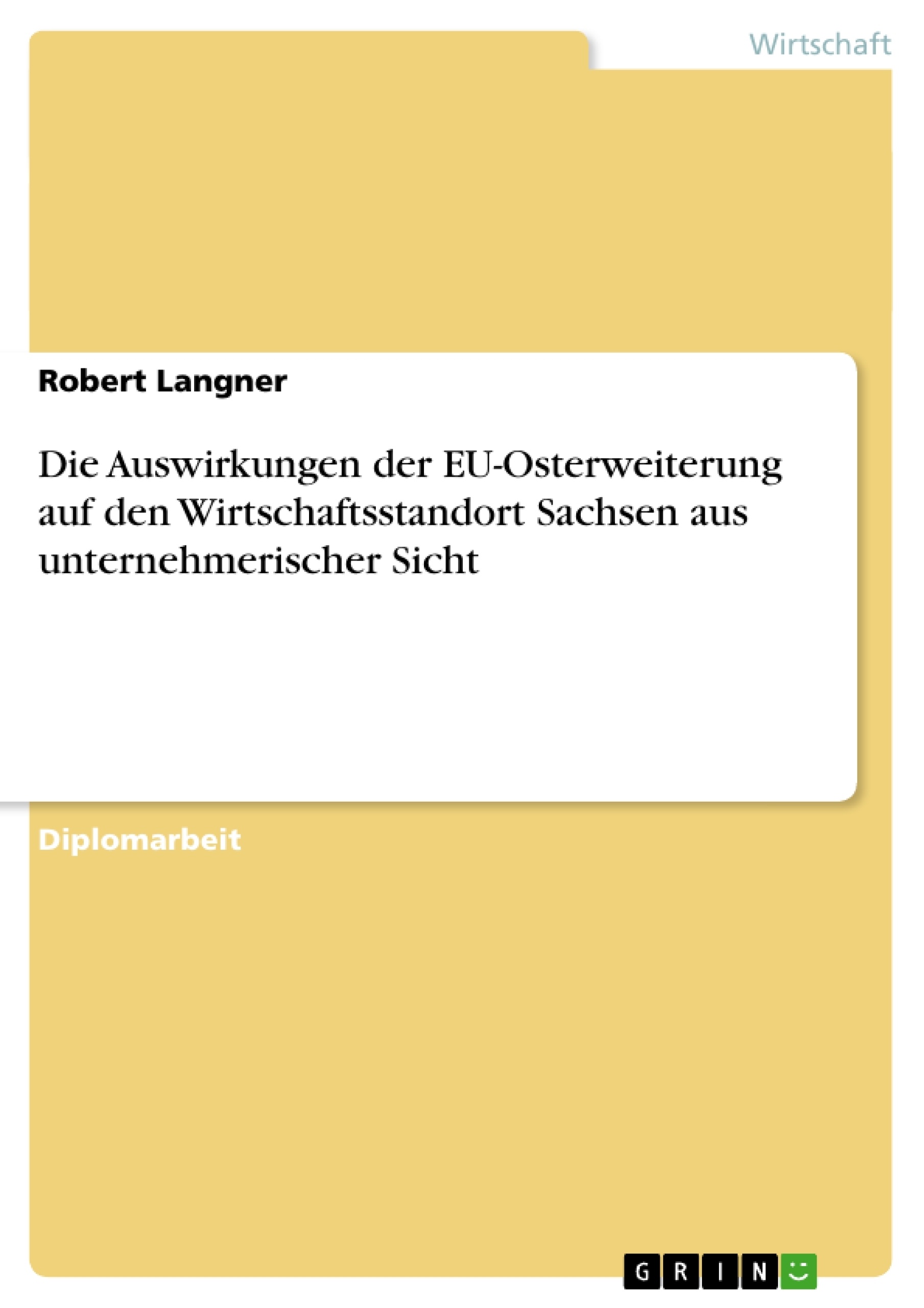Zielsetzung dieser Diplomarbeit war es, die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der EU-Osterweiterung mit möglichst aktuellen Daten für den Freistaat Sachsen und dessen Unternehmer 6 Jahre nach dem Zusammenschluss zu analysieren und bewerten. Daraus sollen Schlussfolgerungen für die unternehmerische Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Sachsen in der Gegenwart und in der Zukunft gezogen werden, sowie Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Unternehmen aufgezeigt werden.
Die Arbeit enthält allgemeine Ausführungen, zum Gegenstand der EU-Osterweiterung, zum Wettbewerb, zu Wettbewerbsstrategien, zur unternehmerischen Standortwahl, zu Standortfaktoren, Daten zu vielen ausgewählten Standortfaktoren, Auswirkungen auf verschiedene Wirtschaftsbereiche sowie Verbesserungsmöglichkeiten für den Standort und im Denken der Unternehmer.
Inhaltsverzeichnis
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
VORWORT
1 GEGENSTAND DER EU-OSTERWEITERUNG
2 WETTBEWERB ZWISCHEN SÄCHSISCHEN UNTERNEHMEN UND UNTERNEHMEN DER NEUEN EU-LÄNDER
2.1 Wettbewerb im wirtschaftlichen Sinn
2.2 Wettbewerbsfähigkeit als Anpassung an den Wettbewerb
2.3 Wettbewerbsstrategien
2.3.1 Kostenführerschaft
2.3.2 Produktdifferenzierung
2.3.3 Marktsegmentierung
2.3.4 Kooperationsstrategie
3 DIE UNTERNEHMERISCHE STANDORTWAHL ÜBER STANDORTFAKTOREN
3.1 Harte Standortfaktoren
3.1.1 Beschaffungsseitige Standortfaktoren
3.1.1.1 Anzahl der Erwerbspersonen
3.1.1.2 Verfügbarkeit von Arbeitskräften
3.1.1.3 Qualifikation der Beschäftigten
3.1.1.4 Lohnstückkosten
3.1.1.5 Infrastruktur
3.1.1.6 Bildungsinfrastruktur sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen .
3.1.1.7 Grundstücke und Mieten
3.1.1.8 Zugang zu Finanzmitteln
3.1.1.9 Beschaffungskontakte
3.1.1.10 Transportkosten
3.1.2 Produktionsbezogene Standortfaktoren
3.1.3 Absatzseitige Standortfaktoren
3.1.4 Staatliche und öffentliche Faktoren
3.2 Weiche Standortfaktoren
3.2.1 Weiche unternehmensbezogene Standortfaktoren
3.2.2 Weiche personenbezogene Standortfaktoren
4 AUSWIRKUNGEN AUF INDUSTRIE UND HANDEL IN SACHSEN
4.1 Vergleich der sächsischen Industrie und der Industrie der NMS
4.2 Positive Auswirkungen der Erweiterung
4.3 Negative Auswirkungen
4.4 Fazit
5 AUSWIRKUNGEN AUF DEN DIENSTLEISTUNGS- UND HANDWERKSSEKTOR IN SACHSEN
5.1 Zusammensetzung des sächsischen Dienstleistungs- und Handwerkssektor
5.2 Positive Auswirkungen
5.3 Negative Auswirkungen
5.4 Fazit
6 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE POLITIK UND FÜR SÄCHSISCHE UNTERNEHMEN ZUR LANGFRISTIGEN SICHERUNG DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DES STANDORTES
THESENBLATT
ANLAGEN - ANLAGENVERZEICHNIS
GESETZESVERZEICHNIS
LITERATURVERZEICHNIS
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vorwort
Zielsetzung dieser Diplomarbeit ist es, die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der EU-Osterweiterung mit möglichst aktuellen Daten für den Freistaat Sachsen 6 Jahre nach dem Zusammenschluss zu analysieren und bewerten. Daraus sollen Schlussfolgerungen für die unternehmerische Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Sachsen in der Gegenwart und in der Zukunft gezogen werden, sowie Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Unternehmen aufgezeigt werden.
Mit der EU-Osterweiterung im Jahre 2004 gingen neben einer Vielzahl von Erwartungen und Freude, über ein weiter vereintes Europa auch Ängste einher.1 Kaum eine Entscheidung der EU hat so viele Menschen polarisiert. Arbeitnehmer, die um ihre Jobs fürchteten, Manager, die sich um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen sorgten und Professoren, die sich über den Standort Deutschland Gedanken machten.2
Vor allem befürchtet wurde, dass auf Grund des hohen Lohngefälles zu den Ländern Polen und Tschechien sächsische Unternehmen vom Markt verdrängt werden könnten, dass deutsche Unternehmen wegen der niedrigen Lohnkosten und Steuervorteilen in den neuen Mitgliedsländern investieren und wegen des hohen Einkommensgefälles eine Massenzuwanderung nach Deutschland erfolgen könnte, die wiederum steigende Arbeitslosigkeit und fallende Löhne zur Folge hätte.3
Aber selbst Wirtschaftsexperten waren sich über die Auswirkungen uneinig.4 Es wurden viele Studien erstellt, in denen jedoch im Großen und Ganzen Integrationsgewinne für die alten als auch für die neuen EU-Länder vorausgesagt wurden.5 Problematisch gesehen wurde jedoch die Anpassung des Handwerks an die neue Situation, sodass vorerst die generelle Freizügigkeit von Arbeitnehmern innerhalb der EU durch Deutschland bis zum Jahr 2011 ausgesetzt wurde.6
Fakt ist, dass das Land Sachsen mit einer Grenze von 577 km7 zu den beiden Beitrittsländern Polen und Tschechien die längste Grenze aller deutschen Bundesländer zu den Beitrittsländern hat und deswegen in besonderem Maße von der EU- Osterweiterung betroffen ist.8 Dem waren sich zum damaligen Zeitpunkt nicht alle Unternehmer bewusst, sodass über die Hälfte der Unternehmer „die EU-Osterweiterung als ein Ereignis einstuft, das für das Unternehmen nur am Rande von Bedeutung ist“.9
Lediglich 8 % aller Unternehmer hatten im Frühsommer 2003 bereits Vorbereitungshandlungen ergriffen und 6 % planten konkrete Vorbereitungshandlungen.10
Mit der Erweiterung zum 01.05.2004 konnte auf Grund der Nähe zudem grundsätzlich erwartet werden, dass die ökonomischen Aktivitäten und somit der Kapitalfluss zwischen Sachsen und den NMS deutlich zunehmen werden.11 Da die Entfernung von Sachsen zu Rumänien und Bulgarien weitaus größer ist, wurde erwartet, dass die Erweiterung am 01.01.2007 eine deutlich geringere Veränderung hervorrufen würde.
Weiterhin treffen Unternehmen, private Haushalte als auch der Staat Standortentscheidungen,12 die sich auf den Wirtschaftsstandort Sachsen auswirken. Im Rahmen der Diplomarbeit wird jedoch hauptsächlich die unternehmerische Standortwahl beleuchtet und am Rande die der privaten Haushalte.
Um wirklich möglichst viele Standortfaktoren zu beleuchten und Auswirkungen der EU-Osterweiterungen auf den Standort Sachsen im Rahmen der Diplomarbeit darstellen zu können, wurden wirtschaftszweigbezogene Problematiken stark verallgemeinert. Bei Erstellung der Diplomarbeit war durchaus bekannt, dass diese begrenzt sein soll, jedoch war es wegen des Umfangs des auszuwertenden Datenmaterials nicht möglich, die Diplomarbeit weiter zu kürzen, ohne dass dabei wichtige Teile weggelassen würden. Weiterhin schien eine Einschränkung des Themas im Verlauf der Bearbeitung nicht als geeignetes Mittel, da die Diplomarbeit sonst unvollständig und weniger wissenschaftlich geworden wäre. Auch auf Grund des wenigen speziell für Sachsen bereitstehenden Datenmaterials musste teilweise ein Vergleich der verallgemeinerten deutschen Daten mit denen der NMS vorgenommen werden. Anhand anderer bereitstehender Daten wurde über innerdeutsche Vergleiche dann ermittelt, wie Sachsen in Deutschland steht, um so eine Vergleichbarkeit mit den NMS herzustellen. Diese Verfahrensweise hat ebenfalls dazu beigetragen, dass die Diplomarbeit einen größeren Umfang hat, als zunächst im Verlauf der Erstellung erwartet wurde.
Da die Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf den Dienstleistungssektor und auf das Baugewerbe zu Beginn der Arbeit größer erschienen, wurde eine getrennte Betrachtung von Industrie und Handel durchgeführt.
1 Gegenstand der EU-Osterweiterung
Im Rahmen der EU-Erweiterung wurden am 01.05.2004 10 neue Mitgliedstaaten aufgenommen. Acht dieser neuen Mitgliedstaaten (Tschechien, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Slowakei, Ungarn und Slowenien) befinden sich davon in Mittel- bzw. Osteuropa. Weiterhin wurden zum 01.01.2007 Bulgarien und Rumänien in die EU aufgenommen. Zum einen wurde damit die EU geographisch erweitert, als auch ein Binnenmarkt geschaffen, mit dem eine teilweise Wirtschafts- und Währungsunion hergestellt wurde. Mit der EU-Osterweiterung wurden in den NMS die vier Grundfreiheiten der EU (freier Dienstleistungs-, Waren- und Kapitalverkehr, sowie Arbeitnehmerfreizügigkeit, welche auch Niederlassungsfreiheit genannt wird) eingeführt.
Auf Grund der Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 45 AEUV) in den NMS wurde eine hohe Migration von Arbeitskräften nach Westeuropa und nach Sachsen erwartet.13 Durch das hohe Einkommensgefälle der AMS zu den NMS und wegen erwarteter Probleme auf dem heimischen Arbeitsmarkt wurde durch viele AMS auf eine unmittelbar vollständige Liberalisierung am 01.05.2004 bzw. am 01.01.2007 verzichtet. Mit einer durch die EU festgelegten insgesamt bis zu 7 jährigen Übergangszeit sollte für neue, als auch für alte Mitgliedstaaten die Möglichkeit geschaffen werden, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Durch Deutschland wurde diese Übergangsfrist voll in Anspruch genommen. Als Hauptgrund dafür führte die deutsche Bundesregierung die hohe Arbeitslosigkeit in den Bundesländern mit Grenzen zu Tschechien oder Polen auf. Die Übergangsfrist bis zum Inkrafttreten der vollständigen Arbeitnehmerfreizügigkeit läuft für die EU-8 demzufolge noch bis zum 30.04.2011, für Rumänien und Bulgarien bis zum 01.01.2014. Durch die NMS, Großbritanien, Irland und Schweden14 wurden keine Übergangsfristen für die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit festgelegt. Diese gilt dort ab Beitritt.15 Ab den o. g. Stichtagen können Arbeitnehmer aus den NMS auch ungehindert und dauerhaft in Deutschland wohnen und einer Beschäftigung nachgehen.
Zudem trat mit der EU-Osterweiterung die Niederlassungsfreiheit in Kraft (Art. 49 AEUV). Dadurch wurde ermöglicht, dass sich natürliche oder juristische Personen sowie Firmen überall innerhalb der EU niederlassen und einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen können. Die Verfahren und Formalitäten, die mit der Niederlassung in einem anderen Staat einhergehen, sollten vereinfacht werden.16
Zudem wurde mit der EU-Osterweiterung der freie Warenverkehr (Art. 34 - 36 AEUV) eingeführt. Nach dieser Regelung wird es Mitgliedstaaten verboten, ungerechtfertigte Beschränkungen des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs aufzunehmen oder aufrecht zu erhalten. Für ungefähr die Hälfte der in der EU gehandelten Waren sind die Regelungen in den Mitgliedstaaten bereits harmonisiert.17 Jedoch hat die Öffnung der Wirtschaft in Richtung der NMS bereits 1991 mit den so genannten Europaabkommen begonnen. Es wurde damit auch begonnen, eine Freihandelszone zu errichten. Mit dem Inkrafttreten der Abkommen wurden Zölle und quantitative Einfuhrbeschränkungen für die Mehrzahl der Produkte aus den NMS unmittelbar abgeschafft bzw. wurden Übergangsfristen zum Abbau getroffen. Bereits vor der EU-Osterweiterung haben sich die Handelsbeziehungen Sachsens und Deutschlands zu den NMS im großen Umfang intensiviert, sodass deren Bedeutung als Handelspartner stark zugenommen hat.18 Durch die EU-Osterweiterung wurden zudem die Transaktionskosten mit industriellen Gütern weiter gesenkt. Auch erfolgte durch die Übernahme der „Acquis Communitaire“ eine Harmonisierung von Rechtsnormen. Noch bestehende Ursprungsregelungen, sowie Unterschiede bei Zolltarifen mit Drittländern wurden so beseitigt. Auch die Reduktion des Zollabfertigungsaufwandes, der Wegfall von Wartezeiten sowie die Standardisierung und Zertifizierung von Waren sind unmittelbare Auswirkung der Erweiterung.19
Durch die EU-Osterweiterung wurde auch die Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV) in den NMS eingeführt. Dadurch sollte ein grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr ermöglicht werden, ohne dass sich der jeweilige Dienstleister im anderen Mitgliedstaat niederlassen muss. Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der Dienstleistungsfreiheit wurde im Jahr 2006 zudem die Dienstleistungsrichtlinie erlassen. Dazu mussten die Mitgliedstaaten einheitliche Ansprechpartner einrichten, dafür sorgen, dass alle Verfahren und Formalitäten elektronisch erledigt werden können, Genehmigungsregelungen vereinfachen sowie diskriminierende Regelungen für Dienstleister aus anderen Mitgliedstaaten abschaffen.20 Außerdem wurde die Richtlinie 2005/36/EG erlassen, nach der die Anerkennung von Berufsqualifikationen europaeinheitlich geregelt wird.21 Jedoch wurden auch für die Dienstleistungsfreiheit Übergangsregelungen geschaffen, die ein volles Wirksamwerden auf den 01.05.2011 verschieben. So wurden für bestimmte Sektoren, wie das Baugewerbe einschließlich verwandter Wirtschaftszweige, den Bereich der Reinigung von Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln sowie der Tätigkeit von Innendekorateuren Einschränkungen vereinbart.22 Diese Einschränkungen gelten jedoch nicht für Selbstständige. Selbstständige genießen bereits seit dem 01.05.2004 die Vorzüge der vollen Dienstleistungsfreiheit.
Eine weitere mit der EU-Osterweiterung einhergehende Regelung ist die Übernahme des freien Kapitalverkehrs (Art. 63 AEUV) in den NMS. Der freie Kapitalverkehr wurde bereits vor EU-Osterweiterung durch die EG Richtlinie 88/361/EWG liberalisiert. Damit einhergehend wurden Investitionen in ausländische Unternehmen, die Eröffnung von ausländischen Bankkonten, die Geldanlage, der Aktienerwerb, der Erwerb von Immobilien innerhalb der EU und anderes erleichtert.23 Als Ausfluss des freien Kapitalverkehrs kann die Einführung des Euros als Zahlungsmittel in der Slowakei, Slowenien und Estland24 gesehen werden. Die Länder Bulgarien, Lettland verfügen über eine feste Wechselkursbindung zum Euro. Eine Euro Einführung wird in diesen Ländern zu einem späteren Zeitpunkt, bisher geplant im Jahr 2014, erfolgen. Polen plant ab 2012 die Zugehörigkeit zur Euro-Zone, Litauen ab 2014, Rumänien ab 2015, Tschechien ab 2015 und Ungarn ab 2015.25
Durch die zwei EU-Erweiterungsrunden wurden in Osteuropa ausschließlich Länder mit einem teilweise weit unter dem damaligen Durchschnitt der alten EU-Länder liegenden BIP aufgenommen. Das Wohlstandsgefälle innerhalb der erweiterten EU ist deswegen sehr groß.26 Dies hat insbesondere Bedeutung für die Verteilung der Mittel aus dem Europäischen Strukturfonds und aus dem Europäischen Sozialfonds und somit auch für Sachsen. Sachsen war bis zur Erweiterung mit einem BIP von beispielsweise 70,3 % des EU-Durchschnitts im Jahr 200127 Höchstfördergebiet. Das Einkommensniveau der gesamten EU ist durch die Aufnahme der neuen Mitgliedstaaten jedoch gesunken, sodass der statistische Effekt erzielt wird, dass ehemals „arme“ Regionen der alten Mitgliedstaaten nach der Aufnahme der NMS im oder über dem EU- Einkommensdurchschnitt liegen und dadurch in Zukunft nicht mehr oder weniger gefördert werden, obwohl sich das dortige Einkommensniveau nicht verändert hat.28
Beispielsweise werden die Regionen Leipzig und Dresden in Zukunft nicht mehr als Höchstfördergebiet behandelt, sodass in den nächsten Jahren spürbar weniger EU-Mittel nach Sachsen fließen.29
Am 20. November 2007 hat die Europäische Kommission zudem eine neue Binnenmarktstrategie unter dem Titel "Ein Binnenmarkt für das Europa des 21. Jahrhunderts"30 vorgelegt. Angestrebt wird damit die verbesserte Umsetzung und Durchsetzung des Binnenmarktrechts, der umfassende Ausbau von Kooperations- und Netzwerkstrukturen auf nationaler und europäischer Ebene sowie die Analyse verschiedener Wirtschaftssektoren, um schlecht funktionierende Märkte zu identifizieren.31 Mit der Schaffung des Binnenmarktes verfolgte die EU das Ziel, die internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu stärken, indem ein großer Heimatmarkt geschaffen und ein unternehmerfreundliches Klima gewährleistet wird.32
Durch bilaterale Vereinbarungen wird die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten außerdem weiter verbessert. So vereinbarten Deutschland und Polen beispielsweise eine engere wirtschaftspolitische Zusammenarbeit.33
Mit der EU-Erweiterung wurden letztendlich vor allem Barrieren für Handel, Auslandsinvestitionen und für die Wanderung von Arbeitskräften reduziert.34 Weiterhin wurde ein großer Teil der Dienstleistungsfreiheit bereits wirksam, und die Grenzkontrollen sind weggefallen. Die Wartezeit wegen Kontrollen an der Grenze hat sich dadurch durchschnittlich von 90 Minuten auf 10 Minuten verkürzt.35 Mit einem vergrößerten Binnenmarkt sind gesamtwirtschaftliche Gewinne zu erwarten gewesen.36
2 Wettbewerb zwischen Sächsischen Unternehmen und Unternehmen der neuen EU-Länder
2.1 Wettbewerb im wirtschaftlichen Sinn
Wettbewerb ist „die Konkurrenz der Teilnehmer auf einem Markt, vor allem der Wettkampf der Verkäufer von Erzeugnissen und Leistungen um die Gunst der Käufer. Der Wettbewerb ist das wichtigste Gestaltungselement der Marktwirtschaft. Er sorgt dafür, dass die volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren den bestmöglichen Verwendungen zugeführt werden und somit für die bestmögliche Güterversorgung in der Volkswirtschaft (Steuerungsfunktion).
Der Wettbewerb ist weiterhin Motor für technischen Fortschritt, für neue qualitativ hochwertige Produkte und für das Bestreben der Unternehmen nach möglichst kostengünstiger Produktion (Antriebsfunktion). Der Wettbewerb bewirkt auch eine leistungsgerechte Verteilung der Gewinne, indem er dafür sorgt, dass nur solche Unternehmen dauerhaft am Markt bestehen können, die wettbewerbsfähig produzieren.“37
Der Wettbewerb kann als Keimzelle des wirtschaftlichen Erfolgs oder Misserfolgs eines Unternehmens gesehen werden38 und gerade in Zeiten der immer weiter fortschreitenden Globalisierung wird der Wettbewerb zwischen verschiedenen Unternehmen und Standorten besonders mit den Schwellenländern größer.39
2.2 Wettbewerbsfähigkeit als Anpassung an den Wettbewerb
Auswirkung des Wettbewerbs ist, dass Unternehmen ständig wettbewerbsfähig sein müssen, um genug Produkte zu verkaufen oder Dienstleistungen zu vermarkten und um Gewinn zu erzielen. „Wettbewerbsfähigkeit bedeutet in der Betriebswirtschaftslehre, dass Unternehmen an den für sie relevanten nationalen oder internationalen Märkten ihre Waren- bzw. Dienstleistungsangebot mit Gewinn absetzen können.“40 Die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens stellt somit den zentralen Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg dar.41 Ist ein Unternehmen im Umkehrschluss dem Wettbewerb nicht gewachsen, so wird es in der Regel nicht mehr lange Bestand haben. Deshalb kann die Wettbewerbsfähigkeit als zentrales Unternehmensziel gesehen werden,42 da mit der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens auch langfristig gesehen Gewinne einhergehen und der Unternehmensbestand gesichert ist, ja sogar eine Expansion möglich ist, weil dies komplementäre Ziele sind.43
Grundsätzlich kann die Wettbewerbsfähigkeit in eine preisliche sowie in eine nicht preisliche Wettbewerbsfähigkeit unterteilt werden.44 „Für die Erreichung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit ist es wichtig, dass ein Unternehmen seine Produkte oder seine Dienstleistungen zu solchen Preisen absetzen kann, dass die entstehenden Kosten gedeckt werden, sowie eine angemessene Rendite, bezogen auf das eingesetzte Kapital, erzielt wird.“45 Die nicht preisliche Wettbewerbsfähigkeit wird gekennzeichnet durch die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung, den Service, welches das Unternehmen im Zusammenhang damit erbringt, das Design eines Produktes, die Finanzierungsbedingungen sowie die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit der Lieferung.46 Auch der Bekanntheitsgrad und das Image eines Produktes haben Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens.47
Der Wettstreit um die Wettbewerbsfähigkeit findet jedoch nicht nur zwischen konkurrierenden Unternehmen, sondern auch zwischen verschiedenen Standorten eines Unternehmens statt. Dabei muss sich jeder Standort dem internationalen Konkurrenzkampf stellen.48
Eine Auswirkung des Wettbewerbs ist jedoch auch, die Spezialisierung von Unternehmen. Es wird für Unternehmen durch zunehmende Konkurrenz schwieriger, eine Spitzenposition am Markt zu behalten.49
Die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens kann jedoch auch durch Subventionen und Fördermittel künstlich aufrecht erhalten bzw. verbessert werden.50
Im Rahmen der Diplomarbeit gilt es zu prüfen, ob die sächsischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb, sowie im Wettbewerb mit den Osteuropäischen Nachbarn gut aufgestellt sind.
2.3 Wettbewerbsstrategien
Grundsätzlich können zur Erreichung der Wettbewerbsfähigkeit verschiedene Strategien verfolgt werden. Es kann dabei in die Basisstrategien der Kostenführerschaft, der Produktdifferenzierung (Innovation) und der Marktsegmentierung unterschieden werden.51 Ziel dieser Strategien ist es die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber konkurrierenden Unternehmen zu stärken. Jedoch stehen sich Unternehmen mit ihren Wettbewerbsstrategien nicht immer als Konkurrenten gegenüber. Weitere Strategie eines Unternehmens kann auch eine Kooperation mit eigentlichen Konkurrenzunternehmen zur Verfolgung von bestimmten Zielen sein.52
Welche Strategie durch welches Unternehmen verfolgt wird, hängt von seinem Umfeld ab. Die genannten Strategien verfolgen dabei die Erreichung von Wettbewerbsvorteilen.53 Die gleichzeitige Verfolgung der Strategien Kostenführerschaft und Produktdifferenzierung ist in der Regel nicht von Erfolg.54 Ein Wechsel der Wettbewerbsstrategie im Zeitablauf ist jedoch durchaus sinnvoll um die Marktposition zu festigen.55
2.3.1 Kostenführerschaft
Die Strategie der Kostenführerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass versucht wird, im Gegensatz zur Konkurrenz geringere Kosten aufzuweisen. Zum einen kann dies durch einen natürlichen Vorteil, z. B. einen günstigen Standort, zum anderen aber auch durch große Stückzahlen und durch Optimierung der Produktionsprozesse erreicht werden.56 Jedoch kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Qualität der Produkte eines Kostenführers meist nur durchschnittlich sein wird.57 Die Produkte werden zudem meist vereinfacht, um mehr produzieren zu können.58 Auch im Vertrieb agieren Kostenführer öfter über das Internet und konzentrieren sich auf Großkunden.59 Grundsätzlich kann es immer nur einen Kostenführer geben, denn wenn diese Strategie von mehreren Wettbewerbern verfolgt wird, dann wird im Allgemeinen eine immer unprofitablere Konkurrenz die Folge sein.60 Vor allem bei Unternehmern aus den NMS in arbeitsintensiven Bereichen der Industrie,61 im Dienstleistungssektor oder im Baugewerbe, wo gerade die Lohnkosten von entscheidender Bedeutung sind, wird diese Wettbewerbsstrategie verfolgt.62
2.3.2 Produktdifferenzierung
Mit dieser Wettbewerbsstrategie geht vor allem die Einzigartigkeit des angebotenen Produktes einher. Hierfür sind die hohe Leistungsfähigkeit eines Produktes und dessen Qualität, aber auch das Design und Image eines Produktes, sowie der angebotene Kundendienst entscheidend.63 Zur Realisierung dieser Strategie müssen Produkte angeboten werden, die woanders nicht zu haben sind und wofür die Kunden bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen.64 Voraussetzung für die Verfolgung dieser Wettbewerbsstrategie ist vor allem eine hohe Innovationsfähigkeit des Unternehmens, überdurchschnittlich gute Produkteigenschaften, ein gut ausgebautes Händlernetz, welches einen umfassenden Service bietet, eine intensive Öffentlichkeitsarbeit sowie hochqualifizierte Mitarbeiter.65
Wenn die Strategie erfolgreich ist, hat dies in der Regel eine erhöhte Kundenloyalität sowie eine geringere Preissensitivität zur Folge.66
Diese Wettbewerbsstrategie findet nach der Theorie vornehmlich bei sächsischen Unternehmen Anwendung und weniger bei denen aus den NMS, da hier laut Studien Wettbewerbsvorteile der alten EU-Länder vorliegen.67 Im Zuge der EU-Osterweiterung wurde diese Wettbewerbsstrategie auch zum Ziel vieler sächsischer Unternehmen, indem sie sich zunehmend auf ein hohen Preis-/ Qualitätssegment fokussieren wollten.68 Beispiele für die klassische Wettbewerbsstrategie der Produktdifferenzierung in Sachsen sind die Fertigung des VW Phaeton in der Gläsernen Manufaktur in Dresden und die Uhrenfertigung in Glashütte.
2.3.3 Marktsegmentierung
Die Strategie der Marktsegmentierung liegt darin, dass sich das Unternehmen nicht mehr auf den Markt als Ganzes konzentriert, sondern lediglich auf einzelne Segmente (bzw. Nischen).69 So können bisherige Marktnischen besetzt werden und einzelne Prozesse verbessert werden. Mit dieser Strategie wird vor allem die Akquisition neuer Kunden verfolgt. Jedoch soll auch erreicht werden, dass die vorhandenen Abnehmer, durch speziell auf die Zielgruppe abgestimmte Problemlösungen, stärker an das Unternehmen gebunden werden. Die Produktangebote müssen dabei so ausgestaltet werden, dass sie den Bedürfnissen der Kunden möglichst nahe kommen.70 Diese Strategie kann in Form einer Produktdifferenzierung oder einer Kostenführerschaft angelegt sein und ist als Modifizierung dieser beiden Strategien zu verstehen.71
2.3.4 Kooperationsstrategie
Sinn der Kooperationsstrategie ist es, mit einem anderen Unternehmen Ziele gemeinsam zu erreichen. Die Kooperationsstrategie kann von der Ausbildung branchenspezifischer Netzwerke bis hin zu einem Joint Venture reichen.72 Diese Wettbewerbsstrategie zeichnet sich meist durch eine größere Effizienz und Schnelligkeit bei der Problemlösung aus. Auch eine Kostenersparnis kann in den häufigsten Fällen erreicht werden.73 Diese Strategie erweist sich auch als sinnvoll, wenn die eigenen Ressourcen des Unternehmens nicht ausreichen oder das Risiko für ein einzelnes Unternehmen zu hoch erscheint.74 Strategische Allianzen sind auch dann nützlich um einen Marktzugang auf bisher nicht erschlossenen Märkten zu bekommen. So kann die bessere Erfahrung eines Allianzpartners auf einem bestimmten Markt genutzt werden, um den eigenen Marktzugang zu erleichtern und zu beschleunigen.75
Eine Zusammenarbeit zwischen sächsischen Unternehmen und Unternehmen aus den NMS im Bereich kleiner Unternehmen ist auf Grund der bisher wenig ausgeprägten wirtschaftlichen Beziehungen, der vorhandenen Sprachbarriere und wegen mangelndem Kapital bisher lediglich in einem geringen Maß erfolgt.76
3 Die unternehmerische Standortwahl über Standortfaktoren
Ein extrem wichtiger Faktor für den unternehmerischen Erfolg ist der Standort77 des Unternehmens. Die Standortwahl eines Unternehmens ist dabei von nachhaltiger Wirkung, weil der Betrieb und dessen Entwicklung langfristig daran gebunden sind78 und ein erheblicher Teil der wirtschaftlichen Beziehungen eines Unternehmens vom Standort abhängig ist.79 Die Standortwahl kann anhand von ökonomischen sowie auch anhand von nicht ökonomischen Kriterien (z. B. persönliche, freizeitbezogene, kulturelle) getroffen werden.80 Sie ist auf Grund einer Vielzahl von zu berücksichtigenden Faktoren meist komplex und schwierig.81 Ein Standort ist allgemein dann geeignet, wenn Anforderungen an den Standort und die Bedingungen am Standort aufeinander abgestimmt sind.82 Die Standortbedingungen ergeben sich dabei aus den verschiedenen Standortfaktoren.
Standortfaktoren sind die Gesamtheit aller Faktoren, die bei der Wahl des Standortes durch ein Unternehmen berücksichtigt werden.83 Damit ein Standortfaktor von Bedeutung ist, muss er sich allgemein auf die Erlöse oder Kosten des Unternehmens auswirken. Auch nicht monetäre Kosten können dafür eine Rolle spielen (z. B. Zeitkosten bei Straßenanbindung) sowie Faktoren, die mittel- oder langfristige Auswirkungen haben (z. B. Ausbildungsmöglichkeiten der Bevölkerung in der Zukunft oder Studienbedingungen an Universitäten, die sich auf die Innovationsfähigkeit des Unternehmens auswirken können).84 Damit ein Standortfaktor entscheidungserheblich wird, muss er in Verfügbarkeit, Qualität und Preis räumlich differieren.85
Standortfaktoren können grundsätzlich nach 2 Klassen unterschieden werden: harte Standortfaktoren und weiche Standortfaktoren.86 Schlechte weiche Standortfaktoren können in der Regel durch gute harte Standortfaktoren ausgeglichen werden, wiederum ist der Ausgleich schlechter harter Standortfaktoren durch gute weiche Standortfaktoren noch nicht empirisch nachgewiesen.87
Weiterhin lässt sich bestimmen, dass große Unternehmen wegen Investitionstätigkeiten deutlich häufiger Standortentscheidungen fällen.88 Bei Unternehmern, die ein Unternehmen neu gründen, und bei kleinen Unternehmen wird meist keine echte Standortwahl durchgeführt, weil diese sich häufig darauf beschränken, den Standort in der Nähe des Wohnortes zu haben.89
3.1 Harte Standortfaktoren
Harte Standortfaktoren schlagen sich unmittelbar in den Erlösen und in den Kosten eines Unternehmens nieder.90
Harte Standortfaktoren können weiterhin in beschaffungsseitige Standortfaktoren, produktionsbezogene Standortfaktoren, absatzorientierte Standortfaktoren91 sowie staatlich festgelegte Standortfaktoren untergliedert werden.92 Auf Grund der hohen Bedeutung, welche den harten Standortfaktoren zukommt, spielen diese bei der unternehmerischen Standortwahl der meisten Unternehmen grundsätzlich die entscheidende Rolle.93
3.1.1 Beschaffungsseitige Standortfaktoren
Für das Thema relevante beschaffungsseitige Standortfaktoren sind der Grundstückspreis und der vorhandene Raum (Anschaffungspreis bzw. Miethöhe), die Struktur der Zulieferer bzw. anderer Dienstleister, der Aufwand für den Bau und die Erhaltung von Betriebseinrichtungen und - anlagen, die Verkehrsbedingungen und insbesondere die Infrastruktur, Energieversorgung (Verfügbarkeit und Kosten), Nachrichtenverbindungen, die Arbeitsmarktbedingungen (Arbeitskräftepotenzial, Lohnniveau, Qualifikation der Arbeitskräfte, Einstellung zur Arbeit), Materialien und insbesondere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Preise), Transportkosten, Beschaffungskontakte sowie die Finanzierungsmöglichkeiten.94
Im Rahmen der Diplomarbeit wird ausführlich auf die Arbeitsmarktbedingungen und alle damit zusammenhängenden Faktoren eingegangen, da diese durch die EU-Osterweiterung unmittelbar am meisten betroffen sind. Die Arbeitsmarktbedingungen in Sachsen wurden zur besseren Übersicht untergliedert in die Anzahl der Erwerbspersonen, die Qualifikation, die Verfügbarkeit der Arbeitnehmer und die Lohnstückkosten.
Weiterhin wird auf die Infrastrukturausstattung, die Bildungsinfrastrukturausstattung sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, die Höhe der Mieten, die Preise für Bauland, den Zugang zu Finanzmitteln, die Beschaffungskontakte und die Transportkosten eingegangen.
Die Struktur der Zulieferer und anderer Dienstleister wurde nicht beleuchtet, da diese Betrachtung zu punktuell hätte durchgeführt werden müssen und eine genaue wirtschaftszweigbezogene Betrachtung im Rahmen der Diplomarbeit nicht erfolgen sollte.
Der Aufwand für den Bau- und die Erhaltung von Betriebseinrichtungen und Anlagen wird in Sachsen und in den NMS auf einem ähnlichen Niveau liegen, sodass erhebliche Abweichungen zwischen Sachsen und den NMS nicht zu erwarten sind. Eine Vergleichbarkeit konnte außerdem nicht hergestellt werden.
Die Verfügbarkeit und die Preise von Materialien, insbesondere von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen können als Standortfaktoren vernachlässigt werden, da mittlerweile alle Güter international gehandelt werden und die NMS nicht über solche Rohstoffvorkommen verfügen, die unmittelbare Standortvorteile hervorrufen würden. Unterschiede hinsichtlich der Einkaufspreise für Materialien ergeben sich im Vergleich zu Unternehmen, die in einem Land sitzen, welches den Euro noch nicht als Zahlungsmittel eingeführt hat, lediglich durch Währungsschwankungen, welche jedoch nicht beeinflussbar sind.
3.1.1.1 Anzahl der Erwerbspersonen
Die Anzahl der Erwerbspersonen ist in Sachsen tendenziell rückläufig. Während im Jahr 2005 noch ca. 2,29 Mio. Erwerbspersonen in Sachsen vorhanden waren, werden es bis zum Jahr 2030 bis zu 30 % weniger sein, auch wenn sich die Erwerbsbeteiligung älterer Menschen durch einen späteren Rentenbeginn, sowie jüngerer Menschen durch verkürzte Ausbildungszeiten wahrscheinlich leicht erhöhen wird.95 Weiterhin ist zu vermerken, dass der Altersdurchschnitt der Erwerbspersonen auf Grund des Geburtendefizits in Sachsen in den Jahren von 1990 bis 201096 und der hohen Wanderungsverluste vor allem von jungen Menschen in den Jahren 1990 bis 200997, nach den Feststellungen des Statistischen Landesamtes steigen wird. Nach den Berechnungen der statistischen Landesämter bestand im Jahr 2005 das Erwerbspersonenpotenzial in Sachsen zu knapp drei
Viertel aus unter 50-jährigen und zu gut einem Viertel aus 50-jährigen und älteren Personen. Der Anteil der älteren Erwerbspersonen wird bis 2020 auf ca. 37 % ansteigen.98 Bereits im Jahr 2007 konnte von einer beginnenden Überalterung des Arbeitsmarktes ausgegangen werden.99 Diese hat sich bis 2010 noch weiter verstärkt.100 Vom sogenannten demografischen Wandel sind insbesondere die Landkreise, weniger hingegen die kreisfreien Städte betroffen.101 Für die Zukunftsorientierung der Unternehmen ist dieser Trend als negativ zu werten, weil die Auswahl an qualifizierten Beschäftigten tendenziell zurückgeht. Allein über leicht steigende Geburtenzahlen102 und Zuwanderung kann dieser Trend kurz- und mittelfristig nicht gestoppt werden.
Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist eine der Neuerungen der EU- Osterweiterung und gilt ab dem Jahr 2011 bzw. für bulgarische und rumänische Staatsbürger ab dem Jahr 2014 uneingeschränkt, weil die Übergangsregelung zur Begrenzung des Zuzugs von Arbeitnehmern ausläuft. Die Attraktivität Sachsens für Arbeitnehmer aus den NMS, besteht in der geringeren Entfernung zum Herkunftsland.103 Die räumliche Nähe verliert jedoch mit steigender Höhe der Löhne an Bedeutung.104 Deswegen kann größtenteils mit einem Zuwanderungsstrom in den strukturstarken Regionen Deutschlands mit hohem Einkommensniveau gerechnet werden.105 Weitere Indikatoren für die Wanderung sind die Integration in den Arbeitsmarkt von ausländischen Arbeitnehmern und die Quote von bereits zugezogenen Immigranten.106 Der hauptsächliche Zuzug in Sachsen wird sich auf die Agglomerationsräume Leipzig und Dresden und dort vor allem auf die Kernstädte beschränken.107 Prognostiziert wurde im Jahre 2004, dass bei sofortiger Freizügigkeit und in Ermangelung von Lohnangleichungen zwischen Deutschland und den NMS innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren ein Zuzug in Sachsen von ca. 100.000 Menschen aus den NMS zu verzeichnen wäre.108 Da die Freizügigkeit jedoch erst im Jahr 2011 in vollem Umfang Wirkung findet und sich die Lohnniveaus in Deutschland und in den NMS im Zeitraum von 2004 bis 2010 weiter angenähert haben, wird der Zuzug vermutlich ein wenig geringer ausfallen. So stiegen die Löhne beispielsweise in Lettland im Jahr 2007 um 31,5 % und 2008 um 23,8 %, in Rumänien im Jahr 2007 um 22,2 % und 2008 um 15,9 %, in Ungarn im Jahr 2007 um 6,9 % und 2008 um 6,2 %, in Polen 2007 um 6,3 % und 2008 um 6,0 %,109 während in Sachsen 2007 lediglich ein Zuwachs von 3,6 % und 2008 von 3,8 % zu verzeichnen war.110 Zwar kann auch weiterhin mit einem stärkeren Lohnanstieg in den NMS als in Sachsen gerechnet werden, dieser wird jedoch deutlich schwächer ausfallen als bisher.111 In Sachsen stiegen die Löhne im Jahr 2009 bei Vollzeitbeschäftigten ohne Sonderzahlungen um durchschnittlich 2,4 %,112 in Tschechien um 4 %113 und in Polen um schätzungsweise bis zu 4,2 %.114 Kurzfristig kann es jedoch auch dazu kommen, dass die Lohnunterschiede zwischen Sachsen und den NMS durch die Finanz- und Wirtschaftskrise und den dadurch bedingten Einsparungen der Unternehmer und der Regierungen in den NMS wieder steigen. Dies zeigt sich durch die besonders starken Auswirkungen der Krise auf die NMS115 und fehlende Konjunkturprogramme wie in Deutschland.116 Dadurch bedingt würde auch das Zuwanderungspotential wieder leicht steigen.
Insgesamt wird sich auch die Anzahl der ausländischen Pendler in Sachsen wegen des Lohngefälles und der günstigeren Wohnbedingungen im Heimatland erhöhen.117 Dadurch erhöht sich auch das Arbeitskräfteangebot in der sächsischen Wirtschaft. Pendlerpotenzial besteht in einem Einzugsgebiet von 100 bis 200 km, je nach dem Ausbau der Straßenverbindung.118 Insgesamt ergibt sich für Sachsen ein geschätztes Pendlerpotenzial von rund 34.500 Personen im Jahr 2010,119 wovon der größte Teil auf Ostsachsen, wegen der unmittelbaren Grenzlage von Görlitz und der Nähe polnischer Herkunftsgebiete mit relativ großer Bevölkerung, entfällt.120 Die Entwicklung des Pendlerpotenzials hängt dabei auch wie das Einwanderungspotenzial von der Entwicklung der Einkommen ab. Ein Fachkräftemangel kann so zumindest in den grenznahen Regionen kompensiert werden.
Seitens der EU wurde bereits mehrfach aufgeführt, dass die Beschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit durch Deutschland ein Fehler war, da sämtliche Studien und Berichte nur positive Auswirkungen feststellten und keine ernsthaften Störungen auf den Arbeitsmärkten zu erwarten seien.121 Zwischen 2004 und 2007 haben schätzungsweise fünf Millionen Arbeiter die osteuropäischen Länder in Richtung Westeuropa verlassen.122 Insbesondere Irland konnte von dieser Entwicklung profitieren, denn in Irland wurde die Arbeitnehmerfreizügigkeit von Beginn an nicht beschränkt. Hier machen seit dem Jahr 2005 die Zuwanderer aus den NMS den größten Anteil an Zuwanderern insgesamt aus.123 Die Zuwanderer sind dabei meist sehr gut qualifiziert,124 sodass wirtschaftliche Vorteile aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit entstanden sind. Voraussetzung dafür war jedoch ein flexibler Arbeitsmarkt, der in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt so nicht existierte.125 Die Flexibilität des Arbeitsmarktes in Deutschland hat sich bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt außerdem nicht entscheidend verbessert,126 sodass Auswirkungen vom Ausmaß wie in Irland nicht zu erwarten sind.127 Die Regulierung des Arbeitsmarktes wurde dabei durch ausländische Investoren bisher als negativ bewertet.128 Jedoch soll die deutsche Arbeitsmarktpolitik noch im Jahr 2011 grundlegend reformiert und transparenter gestaltet werden.129 Außerdem muss das Einwanderungssystem und die Integration in Deutschland besser gesteuert werden, da das derzeitige Bildungsniveau und die Arbeitslosenquote der Zuwanderer in Deutschland weitaus schlechter sind, als bei der einheimischen Bevölkerung.130
Die nicht durchgeführte frühzeitige Öffnung des Arbeitsmarktes für Nachwuchs- und Fachkräfte stellt somit eine verpasste Chance dar, dem demographischen Wandel zumindest teilweise schon früher zu begegnen.131
Im ersten Halbjahr 2010 verzeichnete Sachsen immer noch Wanderungsverluste.132 Bis zum Jahr 2015 werden sich die Wanderungsverluste wegen des erwarteten Zuzugs aber wahrscheinlich hin zu einem ausgeglichenen Wanderungssaldo und eventuell sogar zu einem Zuwanderungsüberschuss entwickeln.133
Problematisch an der bisherigen Beschränkung der Freizügigkeit kann auch gesehen werden, dass Fachkräfte aus den NMS von einem zukünftigen Zuzug nach Deutschland und Sachsen abgeschreckt wurden. „Deutschland hat offensichtlich für seine europäischen Nachbarn als Zielland an Attraktivität verloren“, heißt es.134 So haben beispielsweise die meisten slowakischen Fachkräfte, die bereit zu einem Umzug ins Ausland waren, diesen bereits vollzogen.135 Außerdem lohnt sich durch überdurchschnittliche Lohnsteigerungen im Ingenieursbereich in den NMS ein Umzug nach Deutschland durch die höheren Lebenshaltungskosten nur noch bedingt.136 So profitiert Deutschland nicht mehr von der internationalen Migration und liegt europaweit nur im Mittelfeld bei der Zuwanderung von Fachkräften.137 Trotzdem bestehen besonders bei Fachkräften aus Bulgarien und Rumänien noch große Potenziale.138
Bedingt durch den demographischen Wandel wird es für Unternehmer schwieriger, einen geeigneten Unternehmensnachfolger zu finden.139
3.1.1.2 Verfügbarkeit von Arbeitskräften
Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften ist in Sachsen allgemein gut. Dies wird durch die vergleichsweise hohe Arbeitslosenquote von 11,9 % untermauert.140 Eine besonders große Auswahl haben Unternehmen bei gering Qualifizierten.141 Entscheidend als Standortfaktor ist jedoch vor allem die Verfügbarkeit von Fachkräften.
Grundsätzlich hat Deutschland ein höheres Potenzial an Wissenschaftlern und Ingenieuren als die NMS.142 Sachsen verfügt auch allgemein prozentual über mehr hochqualifizierte Menschen als Gesamtdeutschland, Polen oder Tschechien.143 Von einem echten Fachkräftemangel, wie oft publiziert wird, kann derzeit zwar noch nicht ausgegangen werden, jedoch wird der Bedarf an Fachkräften in den kommenden Jahren weiter steigen.144 So gaben bereits 30 % der Unternehmen im IHK Bereich Sachsen an, durch einen Mangel an Fachkräften an ihrer wirtschaftlichen Entwicklung gehindert zu sein.145 Ausländische Investoren zeigten sich über das Angebot an qualifizierten Facharbeitern und Nachwuchskräften mit Studienabschluss teilweise unzufrieden.146
Bedingt durch die niedrigen Geburtenraten wird es für Unternehmen schwieriger geeignete Auszubildende zu finden,147 sodass teilweise sogar darauf verzichtet wird, Auszubildende einzustellen und offene Lehrstellen zu besetzen.148 Dies liegt aber auch daran, dass die Anforderungen vieler Unternehmen hoch sind und eine größere Auswahl an Bewerbern, wie noch vor wenigen Jahren nicht mehr gegeben ist.149 Nach den Feststellungen der IHK hat aber auch die Motivation und die Leistung der Bewerber abgenommen.150 Jedoch bleibt die Lehrlingsausbildung auch zukünftig ein entscheidendes Instrument geeignetes Fachpersonal heranzuziehen.151
Problematisch ist auch die starke Abwanderung von Fachkräften, so kehrten zwischen 2005 und 2009 durchschnittlich 1500 Führungskräfte und Wissenschaftler Deutschland den Rücken.152 Zu diesem Ergebnis kommt auch der Global Competitiveness Report 2010-2011. In Deutschland ist zur Zeit die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte, der sogenannte „Braindrain“ höher, als beispielsweise in den NMS.153 Davon werden insbesondere die ostdeutschen Bundesländer, darunter auch Sachsen, wegen des bestehenden Lohngefälles zu den westdeutschen Bundesländern und zu anderen Wirtschaftsnationen getroffen. Festgemacht werden kann diese These außerdem am negativen Wanderungssaldo Sachsens.154 Um ein großes Potenzial von Hochqualifizierten langfristig zu sichern, muss insbesondere die Attraktivität Sachsens für diese Gruppe erhöht werden, da ausländische Investoren Sachsen als wenig attraktiv für Hochqualifizierte einschätzen.155
Grundsätzlich ist die Abwanderung von Fachkräften in Sachsen ein Problem, welches über eine erhöhte Zuwanderung durch Green- und BlueCards nicht verbessert werden konnte, sodass über neue unkompliziertere Regelungen für eine geregelte und vor allem qualifizierte Zuwanderung nachgedacht werden muss.156 Zwar wurden für Hochqualifizierte zahlreiche Sonderregelungen verabschiedet, jedoch machten davon im Jahr 2009 lediglich 250 Wissenschaftler Gebrauch.157
Auch die Bereitschaft und Absicht bei den sächsischen Unternehmern auf ausländische Fachkräfte zurückzugreifen, muss zwangsläufig steigen, denn diese war in 2010 bei den meisten Unternehmen im Bereich der sächsischen IHK noch nicht vorhanden.158 Um von einer Zuwanderung von Hochqualifizierten profitieren zu können, muss die Vernetzung der sächsischen Unternehmen mit denen in den NMS vorangetrieben werden.159
Zudem wurde durch die Bundesagentur für Arbeit ein 10 Punkteplan veröffentlicht, der das Fachkräfteangebot in Deutschland steigern soll. Ziele dieses Planes sind: Reduzierung der Schulabgänger ohne Abschluss und Verbesserung des Übergangs in den Beruf, Reduzierung der Studien- und Ausbildungsabbrecher, Erwerbspartizipation und Lebensarbeitszeit von Menschen über 55 erhöhen, Erwerbspartizipation und Arbeitsvolumen von Frauen steigern, die Zuwanderung von Fachkräften steuern, Arbeitszeit von Vollbeschäftigten steigern, Qualifizierung und Weiterbildung vorantreiben, Arbeitsmarkttransparenz erhöhen und flankierende Maßnahmen im Steuer- und Abgabenbereich.160
Weiterhin wurde bereits eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit dem Namen „Fachkräfte der Zukunft“ von Bundesregierung, Arbeitgeberverbänden, Kammern und Gewerkschaften gegründet, welche Handlungsbedarf in der Fachkräfteproblematik indizieren soll.161
Der Standortvorteil Sachsens viele Fachkräfte zu einem moderaten Lohnniveau zu haben, wird sich in Zukunft abschwächen und Unternehmen werden sich darauf einstellen müssen, für Hochqualifizierte höhere Lohnkosten zu haben.162 Inwieweit die Maßnahmen der Arbeitsagentur und der Bundesregierung greifen werden, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen.
3.1.1.3 Qualifikation der Beschäftigten
Das Qualifikationsniveau der sächsischen Beschäftigten ist hoch und in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.163 Sachsen verfügt derzeit außerdem über ein gutes Fachkräftepotenzial.164 So wurde das derzeitige Qualifikationsniveau der Beschäftigten von der Mehrzahl der Unternehmen aller Branchen als hoch eingeschätzt.165 Insbesondere der Anteil an Hoch- und Fachschulabsolventen hat sich in den vergangenen Jahren erhöht.166
Um das Qualifikationsniveau auf Grund des steigenden Innovationsdrucks weiter verbessern zu können, ist der Weiterbildungsbedarf in sächsischen Unternehmen hoch.167 Das Weiterbildungsangebot in Deutschland ist im Vergleich zu den NMS als sehr gut zu bewerten.168 Auch die Qualifikationsanforderungen an die zu besetzenden Stellen sind in den letzten Jahren gestiegen.169
3.1.1.4 Lohnstückkosten
Allgemein sind für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens die Lohnstückkosten ein sehr wichtiger Indikator. Die Lohnstückkosten drücken dabei aus, wie viel Lohn, einschließlich der Lohnnebenkosten, für ein Produkt oder eine Dienstleistungseinheit gezahlt werden muss.170 Einflussfaktoren auf die Lohnstückkosten sind die Arbeitskosten und die Arbeitsproduktivität. Weiterhin hat auch die Wertentwicklung der jeweiligen Landeswährung Einfluss auf die Lohnstückkosten.171 Fällt der Kurs einer Währung, werden die Produkte im Ausland billiger und die Lohnstückkosten fallen. Steigt der Kurs, steigen auch die Lohnstückkosten. Innerhalb des Euroraumes und den Ländern mit festem Wechselkurs hat die Entwicklung der Währung jedoch keinen Einfluss mehr, sodass dieser Einflussfaktor mit dem Beitritt aller NMS in die Eurozone wegfallen wird.
Im Zeitraum von 1995 bis 2002 stiegen in Tschechien und Polen die Lohnstückkosten um ca. 59 % bzw. um ca. 53 %, während sie in Sachsen um ca. 14 % zurückgingen.172 Gründe dafür liegen im deutlichen Anstieg der Arbeitskosten in Tschechien und Polen in diesem Zeitraum, welche nicht durch eine im gleichen Umfang steigende Produktivität ausgeglichen werden konnten. In Sachsen stiegen in diesem Zeitraum hingegen die Arbeitskosten in geringerem Umfang als die Produktivität.173
Die Arbeitskosten in Sachsen sind mit durchschnittlich 20,75 € pro Stunde im Vergleich zu Tschechien mit 8,81 € pro Stunde, Polen mit 7,02 € pro Stunde oder Bulgarien mit 2,17 € pro Stunde174 hoch und mindern deswegen die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Sachsen für Investoren.175 Jedoch zeigt die Entwicklung deutlich, dass die Arbeitskosten in den NMS auch zwischen 2000 und 2010 weiter deutlich gestiegen sind.176 So nähern sich die Arbeitskosten innerhalb der EU allgemein über einen längeren Zeitraum immer weiter an.177 Durch die steigenden Arbeitskosten haben die NMS grundsätzlich ein wenig an Attraktivität für Investoren verloren.178
Die vorhandenen Lohnvorteile der NMS werden jedoch durch eine immer noch niedrigere Produktivität als in Sachsen in vielen Sektoren relativiert,179 denn die Produktivität der Belegschaft kann in Sachsen als hoch eingeschätzt werden180 und hat meist einen Vorsprung gegenüber den NMS. Jedoch ist in internationalisierten Sektoren die Produktivität in den NMS auf einem ähnlich hohen Niveau wie in Sachsen.181 Die Produktivitätsentwicklung dürfte durch die Überalterung des Arbeitsmarktes in Sachsen jedoch gehemmt werden.182 Zwar sind ältere Arbeitnehmer grundsätzlich nicht weniger produktiv als jüngere, jedoch sind wegen der mit dem Alter sinkenden Innovationsfähigkeit und Innovationsbereitschaft bzw. wegen unzureichender Erneuerung der Humankapitalbasis negative Effekte auf die Entwicklung der Produktivität nicht auszuschließen.183
Die Produktivität eines Unternehmens hängt neben den eingesetzten Produktionsprozessen, dem technologischem Standard des Unternehmens, der Ausbildung der Beschäftigten und der Motivation der Beschäftigten auch maßgeblich von der Arbeitszeit der Beschäftigten ab. Hinsichtlich der Arbeitszeit ist Sachsen in den meisten Branchen eine 40 Stundenwoche maßgebend. Im Bereich der Automobilindustrie lag Sachsen mit 1648 Arbeitsstunden je Beschäftigtem gegenüber Gesamtdeutschland im Jahr 2006 mit ca. 1448 Arbeitsstunden deutlich besser.184 Insgesamt beträgt die durchschnittliche tariflich vereinbarte Arbeitszeit in Ostdeutschland 38,9 Stunden pro Woche.185 Vergleichsweise liegt diese für Gesamtdeutschland bei 37,7 Stunden pro Woche.186 Die tarifliche Arbeitszeit in den NMS beträgt hingegen 40 Stunden pro Woche.187 Wird dies auf die jährlichen Arbeitsstunden hochgerechnet, so nimmt Rumänien nach einer Untersuchung des Institutes der deutsches Wirtschaft Köln mit 1856 Stunden vor Estland, Polen, Ungarn und Bulgarien den Spitzenplatz in Europa ein.188 Die tatsächlichen Arbeitszeiten liegen gegenüber den tariflichen Arbeitszeiten jedoch auf Grund von Überstunden sowohl in Sachsen, als auch in den NMS in der Regel höher.
Werden Bezahlung und Produktivität nach aktuellen Unternehmensbefragungen gegenübergestellt, so nimmt Deutschland gegenüber den NMS nach dem Global Competitiveness Report 2010-2011 einen mittleren Platz ein. Beispielsweise liegen die Slowakei, Tschechien, Litauen und insbesondere Estland im Vergleich noch vor Deutschland.189 Dieses Ergebnis ist bereits Indiz, dass die Bereitschaft der Unternehmen zu einer Investition in den NMS nachgelassen hat. Bezieht man diese Ergebnisse auf Sachsen, so wäre es noch leicht besser einzuordnen als Gesamtdeutschland. Die Produktivität der sächsischen Wirtschaft ist zwar noch nicht auf dem gesamtdeutschen Niveau,190 die Nettoarbeitskosten fallen mit weniger als 80 % des gesamtdeutschen Durchschnitts191 jedoch geringer aus. Gegenüber dem gesamtdeutschen Schnitt gemessen am Umsatz pro Beschäftigtem lag Sachsen im Jahr 2006 in Bereich der Automobilindustrie sogar ca. 20 % höher. So wurde pro Beschäftigten ein Umsatz von ca. 500.000 € erwirtschaftet.192 Tendenziell ist nach dem Global Competitiveness Report 2010-2011 zu erwarten, dass in den NMS die Produktivität in noch nicht internationalisierten Bereichen durch neue Produktionsprozesse und einen höheren Technologietransfer193
[...]
Tarifverdienste und Arbeitszeiten, S. 25.
1 vgl. Fröhlingsdorf et al. 2004, S. 100 ff.
2 vgl. Fröhlingsdorf et al. 2004, S. 100 ff.
3 vgl. Brücker 2004.
4 vgl. Fröhlingsdorf et al. 2004, S. 102.
5 vgl. Europäische Kommission: Wirtschaft - wachstum [ sic! ] und beschäftigung [ sic! ].
6 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2007, S. 1. V
7 vgl. Statistisches Landesamt Sachsen: Sachsen in Zahlen 2010, S. 2.
8 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. I.
9 Gerstenberger et al. 2004, S. 236.
10 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 236.
11 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 10 f und S. 24.
12 vgl. New Economy Wien: Standortfaktoren.
13 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 10.
14 vgl. Elrick et al. 2006, S. 1.
15 vgl. EurActiv: Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU-27; vgl. Lorenz S.10 f. 1
16 vgl. Europäische Kommission: Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt.
17 vgl. Europäische Kommission: Der Binnenmarkt für Waren.
18 siehe Anlage 1; vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2007, S. 12 ff. 2
19 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2007, S. 20; Gerstenberger et. al. 2004, S. 56.
20 vgl. Europäische Kommission: Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt.
21 vgl. Europäische Kommission: Richtlinie 2006/36/EG in der Praxis.
22 vgl. Bernstorf.
23 vgl. Europäische Kommission: Der freie Kapitalverkehr.
24 vgl. Scherff 2010.
25 vgl. Richter & Dyballa Verlagsgesellschaft mbH.
26 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 7.
27 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 27.
28 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2007, S. 7.
29 vgl. Arendt et al. 2010, S. 68.
30 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: EU - Binnenmarkt. 1. Neue Binnenmarktstrategie.
31 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: EU - Binnenmarkt. 1. Neue Binnenmarktstrategie.
32 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: EU - Binnenmarkt. 2. Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen.
33 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Brüderle und stellvertretender polnischer Premierminister Pawlak vereinbaren engere wirtschaftspolitische Zusammenarbeit.
34 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2007, S. 1.
35 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 151.
36 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2007, S. 1. 5
37 vgl. Bibliographisches Institut : Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag, Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2009, Stichwort: Wettbewerb.
38 vgl. Macharzina/ Wolf 2008, S. 272.
39 vgl. A. T. Kearny: Schwellenländer erhöhen Druck auf etablierte Unternehmen. 6
40 Wikipedia: Stichwort Wettbewerbsfähigkeit.
41 vgl. Macharzina/Joachim Wolf 2008, S. 220.
42 vgl. Fischer 2006, S. 22.
43 vgl. Fischer 2006, S. 23 ff.
44 vgl. Gabler Verlag: http://wirtschaftslexikon.gabler.de, Stichwort: internationale Wettbewerbsfähigkeit.
45 Wikipedia: Stichwort Wettbewerbsfähigkeit; vgl. Gabler Verlag: http://wirtschaftslexikon.gabler.de, Stichwort: internationale Wettbewerbsfähigkeit.
46 vgl. Wikipedia: Stichwort Wettbewerbsfähigkeit; vgl. Gabler Verlag: http://wirtschaftslexikon.gabler.de, Stichwort: internationale Wettbewerbsfähigkeit.
47 vgl. Wikipedia: Stichwort Wettbewerbsfähigkeit.
48 vgl. Donges/ Schleef 2001, S. 43.
49 vgl. Macharzina/ Wolf 2008, S. 266.
50 vgl. Kortmann 2004, S. 462 ff.
51 vgl. Macharzina/ Wolf 2008, S. 272 ff.
52 vgl. Verlag C.H. Beck: Vahlens großes Wirtschaftslexikon, 2. Auflage, Band 4, Seite 2363, Stichwort: Wettbewerbsstrategie.
53 vgl. Macharzina/ Wolf 2008, S. 272.
54 vgl. Macharzina/ Wolf 2010, S. 291 f.
55 vgl. Macharzina/ Wolf 2010, S. 292.
56 vgl. wirtschaftslexikon24.net: Stichwort: Kostenführerschaft; vgl. Macharzina/ Wolf 2008, S. 272.
57 vgl. Macharzina/ Wolf 2008, S. 272.
58 vgl. Macharzina/ Wolf 2008, S. 273.
59 vgl. Macharzina/ Wolf 2008, S. 273 f.
60 vgl. Gabler Verlag: Gabler Wirtschaftslexikon, 15. Auflage, Band S-Z S. 3487, Stichwort: Wettbewerbsstrategie.
61 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2007, S. 23 f.
62 Zum Dienstleistungssektor und Baugewerbe vgl. mit Gliederungspunkt 5. 9
63 vgl. Macharzina/ Wolf 2008, S. 279 f.
64 vgl. Macharzina/ Wolf 2008, S. 279 f.
65 vgl. Macharzina/ Wolf 2008, S. 279 f.
66 vgl. Verlag C.H. Beck: Vahlens großes Wirtschaftslexikon, 2. Auflage, Band 1 Seite 452.
67 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2007, S. 23 f.
68 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 71.
69 vgl. Macharzina/ Wolf 2010, S. 290 f.
70 vgl. Verlag C.H. Beck: Vahlens großes Wirtschaftslexikon, 2. Auflage, Band 3 Seite 1409; vgl. Macharzina/ Wolf 2010, S. 290 f.
71 vgl. Macharzina/ Wolf 2010, S. 290 f.
72 vgl. Verlag C.H. Beck: Vahlens großes Wirtschaftslexikon, 2. Auflage, Band 4 Seite 2019.
73 vgl. Macharzina/ Wolf 2010, S. 274 f.
74 vgl. Moschett/ Swoboda/ Zentes 2005, S. 294 f; vgl. Macharzina/ Wolf 2010, S. 274 f.
75 vgl. Macharzina/ Wolf 2010, S. 275.
76 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 152 ff. und S. 244. 11
77 „Geografischer Ort, an dem ein Betrieb Güter erstellt oder verwertet bzw. räumliche Lage der einzelnen Teile einer Unternehmung, eines Betriebs oder einer Abteilung zueinander und ihre möglichst optimale Zuordnung.“ (Standort nach Gabler Verlag: Gabler Wirtschaftslexikon, 15. Auflage, Band S-Z S. 2883)
78 vgl. Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG 2001: Das Lexikon der Wirtschaft - Grundlegendes Wissen von A - Z, Kapitel 7, S. 301; vgl. Verlag C.H. Beck: Vahlens großes Wirtschaftslexikon, 2. Auflage, Band 4 Seite 1976.
79 vgl. New Economy Wien: Standortfaktoren, S. 45.
80 vgl. Gabler Verlag: Gabler Wirtschaftslexikon, 15. Auflage, Band S-Z S. 2885, Stichwort: Standortwahl.
81 vgl. New Economy Wien: Standortfaktoren, S. 46.
82 vgl. Verlag C.H. Beck: Vahlens großes Wirtschaftslexikon, Band 4 Seite 1978.
83 vgl. Gabler Verlag: http://wirtschaftslexikon.gabler.de, Stichwort: Standortfaktoren.
84 vgl. New Economy Wien: Standortfaktoren, S. 46.
85 vgl. New Economy Wien: Standortfaktoren, S. 46.
86 vgl. Gabler Verlag: http://wirtschaftslexikon.gabler.de, Stichwort: Standortfaktoren.
87 vgl. New Economy Wien: Standortfaktoren, S. 50.
88 vgl. New Economy Wien: Standortfaktoren, S. 47.
89 vgl. Verlag C.H. Beck: Vahlens großes Wirtschaftslexikon, Band 4 Seite 1978; vgl. New Economy Wien: Standortfaktoren, S. 46 f.
90 vgl. Gabler Verlag: http://wirtschaftslexikon.gabler.de, Stichwort: Standortfaktoren.
91 vgl. Gabler Verlag: Gabler Wirtschaftslexikon, 15. Auflage, Band S-Z S. 2884.
92 vgl. Verlag C.H. Beck: Vahlens großes Wirtschaftslexikon, 2. Auflage, Band 4 Seite 1975 ff.
93 vgl. New Economy Wien: Standortfaktoren, S. 46.
94 vgl. Gabler Verlag: Gabler Wirtschaftslexikon, 15. Auflage, Band S-Z, S. 2884; vgl. Verlag C.H. Beck Vahlens großes Wirtschaftslexikon 2. Auflage, Band 4, Seite 1975 ff.
95 vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2009, S. 58 ff.
96 siehe Anlage 2.
97 siehe Anlage 3.
98 siehe Anlage 4 und 5; vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2009, S. 58 ff.
99 vgl. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern: Fachkräfte Monitoring 2007 , S. 18.
100 vgl. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern: Fachkräfte Monitoring 2010 , S. 44.
101 vgl. Arendt et al. 2010, S. 35 ff.
102 siehe Anlage 6.
103 vgl. Arendt et al. 2010, S. 81 ff.
104 vgl. Gerstenberger et al. 2004 , S. 176.
105 vgl. Donges / Schleef 2001, S. 51.
106 vgl. Arendt et. al. 2010, S. 83.
107 vgl. Gerstenberger et al. 2004 , S. 176.
108 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 178.
109 siehe Anlage 7 und vgl. Grabitz S. 1 ff.
110 vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Verdienste und Arbeitszeiten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich im Freistaat Sachsen S. 5; eigene Berechnung.
111 vgl. Steinacher: Die Zeiten hoher Reallohnzuwächse sind in Polen vorerst vorbei.
112 vgl. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Verdienste und Arbeitszeiten im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich im Freistaat Sachsen S. 5.
113 vgl. Kubelkova.
114 vgl. Steinacher: Die Zeiten hoher Reallohnzuwächse sind in Polen vorerst vorbei.
115 vgl. Green.
116 vgl. Ernst & Young 2009, S. 14 ff.
117 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 183.
118 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 27.
119 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 187 f: Es wurde das Mittel aus dem Pendlerpotenzial für 2004 und für 2015 gebildet.
120 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 186 ff.
121 vgl. EurActiv: Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU-27.
122 vgl. Green.
123 siehe Anlage 8.
124 vgl. Quinn.
125 vgl. Heinen/ Pegels.
126 vgl. Schwab 2010, S. 445 - 448.
127 vgl. Heinen/ Pegels.
128 vgl. Gauselmann/ Jindra 2010, S. 284; Paulicks 2010, S. 10.
129 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Jahreswirtschaftsbericht 2011, S. 39; vgl. Bundesagentur für Arbeit: Perspektive 2025: Fachkräfte für Deutschland 2011, S. 13 ff.
130 vgl. Astheimer 2010.
131 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 226.
132 siehe Anlage 9.
133 vgl. Arendt et al. 2010, S. 83.
134 vgl. Astheimer: Deutschland verliert Spitzenkräfte.
135 vgl. FOCUS Online: Osteuropäische Fachkräfte - Kaum Interesse an Deutschland. 19
136 vgl. FOCUS Online: Osteuropäische Fachkräfte - Kaum Interesse an Deutschland; vgl. FOCUS Online: Osteuropäische Fachkräfte - Tschechien: Steigende Löhne.
137 vgl. Astheimer: Deutschland verliert Spitzenkräfte.
138 vgl. FOCUS Online: Osteuropäische Fachkräfte - Rumänien: 20000 Ingenieursabsolventen.
139 vgl. Arendt et al. 2010, S. 45.
140 vgl. Statistisches Landesamt Sachsen: Arbeitsmarkt.
141 vgl. Arendt et al. 2010, S. 28 f.
142 vgl. Schwab 2010, S. 493.
143 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 41 f; vgl. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft: Bundesländerranking 2010 Hochqualifizierte.
144 vgl. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern : Fachkräfte Monitoring 2007 S. 3.
145 vgl. Industrie- und Handelskammer zu Leipzig: Fachkräftebedarf dauerhaft decken - Unternehmerische Herausforderung in Zeiten des Demographischen Wandels.
146 vgl. Gauselmann/ Jindra 2010, S. 284 ff.
147 vgl. Hoeche: Berufsausbildung in Ostdeutschland steht vor großen Herausforderungen.
148 vgl. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern: Fachkräfte Monitoring 2010, S. 14.
149 vgl. Hoeche: Mismatch: Probleme bei Besetzung von Ausbildungsstellen.
150 vgl. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern: Fachkräfte Monitoring 2010, S. 44.
151 vgl. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern: Fachkräfte Monitoring 2010, S. 24.
152 vgl. Astheimer: Deutschland verliert Spitzenkräfte.
153 vgl. Schwab 2010, S. 165.
154 siehe Anlage 9.
155 vgl. Paulicks 2010, S. 10 ff.
156 vgl. Donges / Schleef 2001, S. 49 f; vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Jahreswirtschaftsbericht 2011, S. 38.
157 vgl. Astheimer: Deutschland verliert Spitzenkräfte.
158 vgl. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern: Fachkräfte Monitoring 2010, S. 5.
159 vgl. Arendt et al. 2010, S. 79.
160 vgl. Bundesagentur für Arbeit: Perspektive 2025: Fachkräfte für Deutschland 2011, S. 13 ff.
161 vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Jahreswirtschaftsbericht 2011, S. 38.
162 vgl. Arendt et al. 2010, S. 101 ff.
163 vgl. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern: Fachkräfte Monitoring 2010, S. 20 ff.
164 vgl. Arendt et al. 2010, S. 65.
165 vgl. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern : Fachkräfte Monitoring 2007 S. 3; Die sächsischen Industrie- und Handelskammern: Fachkräfte Monitoring 2010 S. 5.
166 vgl. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern : Fachkräfte Monitoring 2007 S. 3; Die sächsischen Industrie- und Handelskammern: Fachkräfte Monitoring 2010 S. 5.
167 vgl. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern: Fachkräfte Monitoring 2010, S. 6.
168 vgl. Schwab 2010, S. 424 und 425.
169 vgl. Die sächsischen Industrie- und Handelskammern: Fachkräfte Monitoring 2010, S. 5. 23
170 vgl. Wilsdorff.
171 vgl. Gerstenberger et al. 2004 , S. 38 f.
172 siehe Anlage 10.
173 siehe Anlage 11.
174 siehe Anlage 12.
175 vgl. business-wissen.de: Standortvorteil.
176 siehe Anlage 13.
177 vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland: Verdienste und Arbeitskosten 2008, S. 32 ff; vgl. die Ausführungen zu Gliederungspunkt 3.1.1.1.
178 vgl. Kinkel 2009; siehe Anlage 9 und 10.
179 vgl. Heyen/ Kunze/ Wießner 2004, S. 9.
180 vgl. Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH: Kosten; vgl. Paulicks 2010, S. 10.
181 vgl. Gerstenberger et al. 2004, S. 40, S. 216.
182 vgl. Arendt et al. 2010, S. 43 ff.
183 vgl. Arendt et al. 2010, S. 44.
184 siehe Anlage 14.
185 Statistisches Bundesamt Deutschland: Verdienste und Arbeitskosten. Index der Tarifverdienste und Arbeitszeiten, S. 29.
186 Statistisches Bundesamt Deutschland: Verdienste und Arbeitskosten. Index der 25
187 vgl. Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände 2010.
188 vgl. Bild.de: Arbeitszeiten im Europa-Vergleich.
189 vgl. Schwab 2010, S. 449.
190 vgl. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft: Bundesländerranking 2010 Produktivität. Anmerkung: Das hier ermittelten Produktivitätsranking ist jedoch nur begrenzt aussagekräftig, da die Produktivität am BIP pro Erwerbstätigem ermittelt wurde und die erzielbaren Preise der Unternehmen in den alten Bundesländern höher sind, als in Sachsen, und somit auch ein höheres BIP dort erzielt werden kann. Zudem hat das typischerweise wenig produktive Baugewerbe in Ostdeutschland eine größere Bedeutung und betriebsgrößenbedingte Kostenvorteile können in Sachsen auf Grund kleinerer Betriebsgrößen nicht ausgenutzt werden. Auch höherwertige Unternehmensfunktionen sind in Sachsen weit weniger angesiedelt als in Westdeutschland, weil kaum Unternehmenshauptsitze nach Sachsen verlegt oder in Sachsen gegründet wurden (vgl. Arent et. al. 2010, S. 12 - 15).
191 vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland: Nettoarbeitskosten je geleistete Stunde im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich nach Bundesländern 2008.
192 siehe Anlage 15.
193 vgl. Schwab 2010, S. 466.