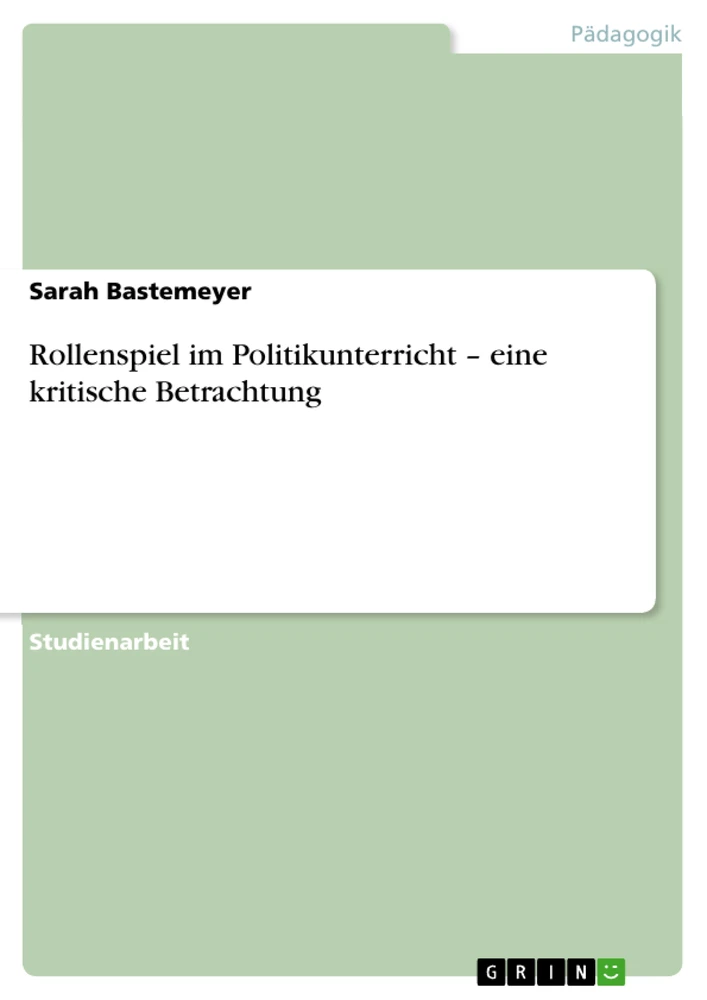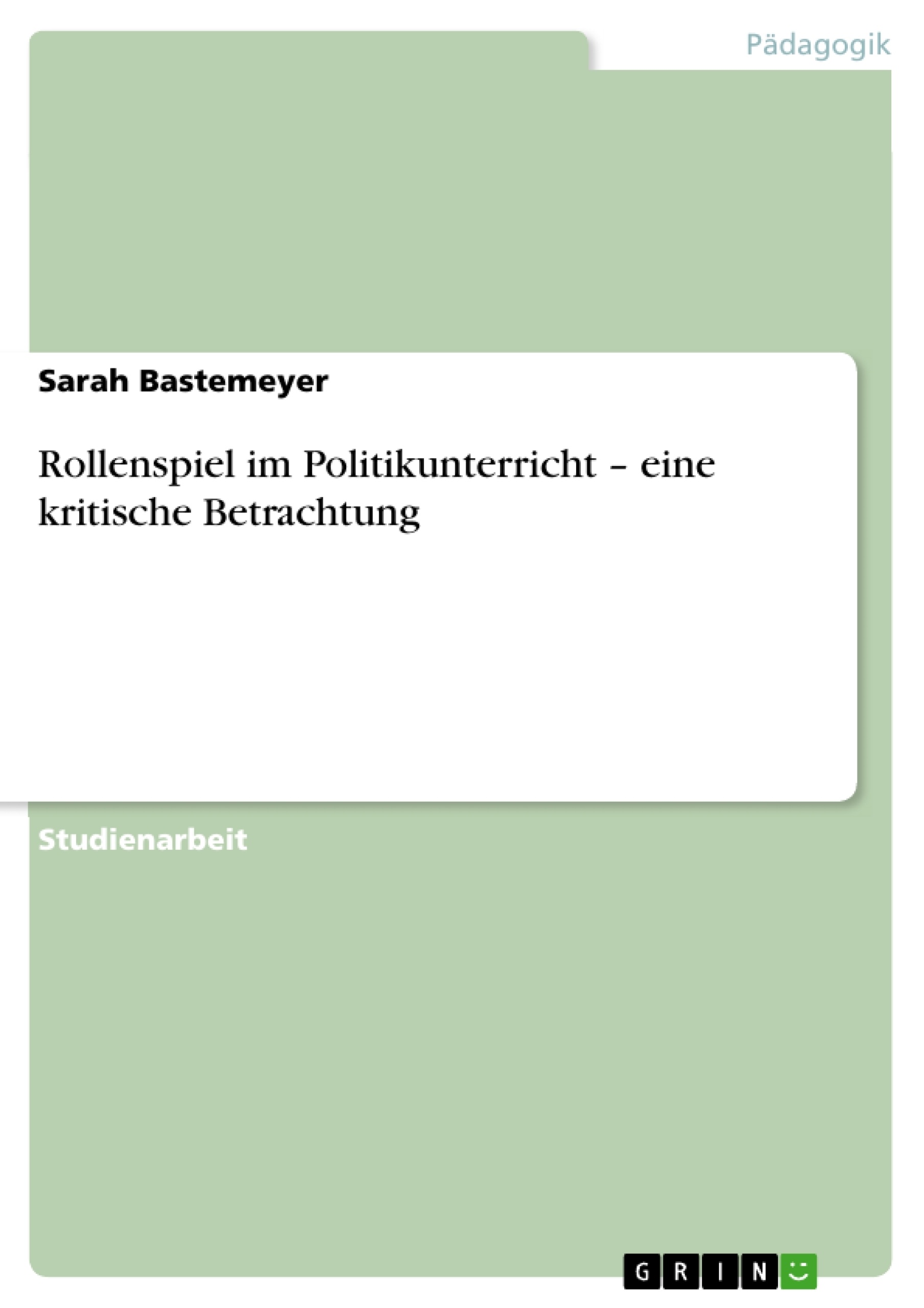„Die Handlungsorientierung im Politikunterricht ist ein Fortschritt in der Varianz der Unterrichtsmethoden.“ Eine dieser Methoden ist das Rollenspiel, wobei es keineswegs als spezifische Methode für den Politikunterricht verstanden werden soll. Das Rollenspiel ist in unterschiedlichen Fächern und in unterschiedlichen Klassenstufen und Schulformen einsetzbar. In dieser Ausarbeitung soll der Fokus allerdings auf die kritische Betrachtung des Rollenspiels im Politikunterricht gelegt werden.
Die Handlungsorientierung im Politikunterricht und somit auch das Rollenspiel, als eine Methode dessen, stehen in der Diskussion. Kritiker befürchten beispielsweise, dass der Wissenserwerb gegenüber den Methoden und zeitaufwändigen Unterrichtsschritten vernachlässigt wird. Befürworter beschreiben die Prinzipien des sozialen Lernens und das Prinzip der Handlungsorientierung „[…] als variantenreiche und fruchtbare Konzepte der Gestaltung des Politikunterrichts […], die den konkreten Unterricht beleben, die Subjektrolle der Schülerin und des Schülers stärken, Verantwortungsbewusstsein für das eigene Tun wecken und Engagement vorbereiten können.“
Auf Grund dieser widersprüchlichen Meinungen, soll sich diese Arbeit mit dem Nutzen eines handlungsorientierten Politikunterrichts beschäftigen. Konkret wird die kritische Betrachtung an der Methode des Rollenspiels vorgenommen, da dieses die vermutlich bekannteste Methode ist, mit der „Lehrerinnen und Lehrer wahrscheinlich die meisten Erfahrungen haben […]“.
Durch die Definition der Methode des Rollenspiels und der Begriffe „Rolle“ und „Rollenspiel“ wird diese Hausarbeit eingeleitet. Anschließend werden die Chancen, Risiken und Grenzen des Rollenspiels im Politikunterricht betrachtet und analysiert. Im Folgenden werden die gewonnenen Erkenntnisse anhand eines konkreten Fallbeispiels konkretisiert und reflektiert. Abschließend wird im Rahmen einer Schlussbetrachtung ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die didaktische Methode: Rollenspiel
2.1 Definition des Begriffs „Rolle“
2.2 Definition des Begriffs „Rollenspiel“.
3. Das Rollenspiel im Politikunterricht
3.1 Das Verständnis der Methode in der fachdidaktischen Literatur
3.2 Gefahren und Chancen des Rollenspiels im Politikunterricht
4. Reflexion der Lernmöglichkeiten anhand eines konkreten Beispiels
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis