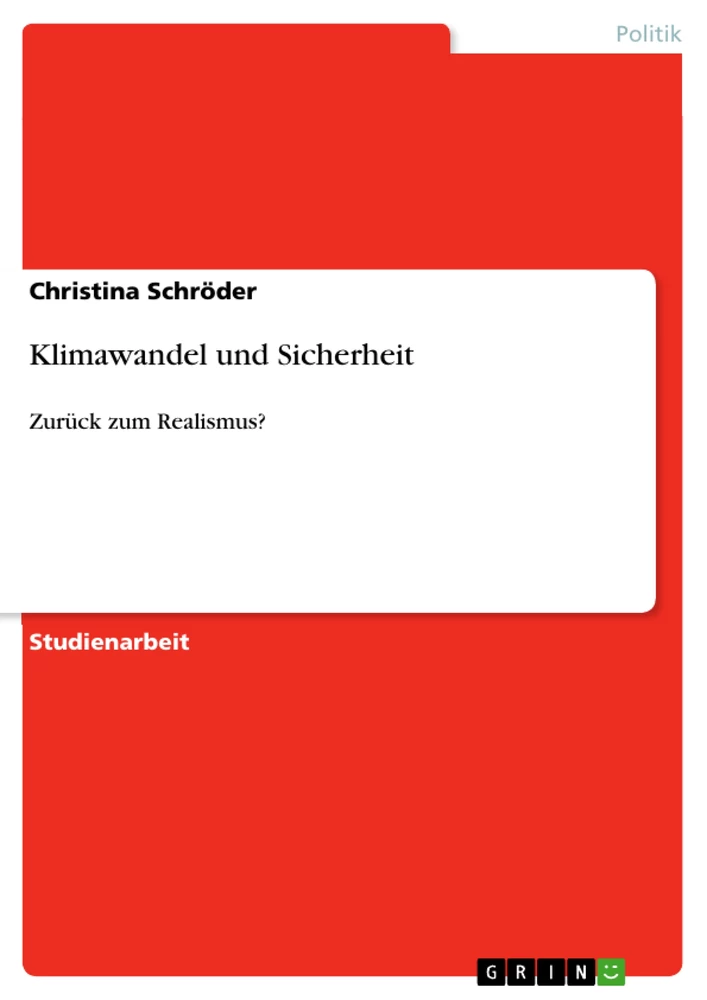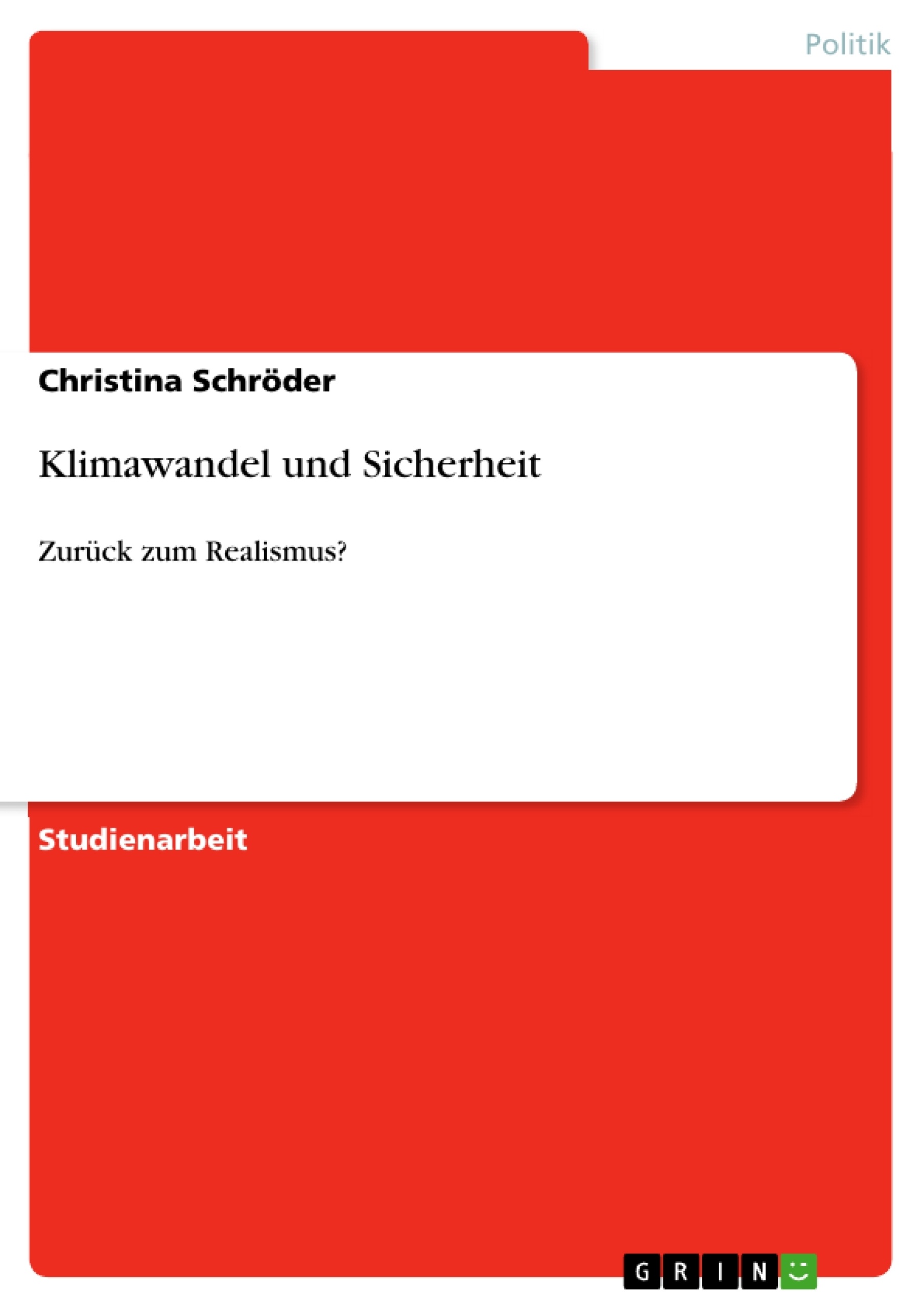Im Gegensatz zur wissenschaftlichen Debatte um Klimasicherheit, die sich sozialkonstruktivistischer oder komprehensiver Sicherheitsverständnisse bedient, bringen Staaten die Bedrohungen durch den Klimawandel häufig mit ihrer nationalen Sicherheit in Verbindung und propagieren Strategien, die dem Erhalt ihrer relativen Macht im internationalen System am zuträglichsten erscheinen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist abseits der Neudefinition und Versicherheitlichung des Klimawandels eine alternative analytische Betrachtung der Klimasicherheit unter Zuhilfenahme realistischer Ansätze und besonderer Berücksichtigung der Staatenpraxis aufzuzeigen. Diese realistische Perspektive kann bei wenigen Modifikationen einen Mehrwert für die Analyse der Klimasicherheit schaffen. Zeitgleich sollen jedoch exemplarisch Grenzen und Schwächen einer realistischen Bearbeitung der Klimasicherheit aufgezeigt werden.
Inhalt
ABKÜRZUNGEN
TABELLENVERZEICHNIS
ABSTRACT
A. EINFÜHRUNG
B. KLIMAWANDEL UND SICHERHEIT: GRUNDZÜGE DES DISKURSES
I. Versicherheitlichung des Klimawandels
II oder Erweiterung des Sicherheitsbegriffs?
C. STAATENPRAXIS: ZURÜCK ZUR NATIONALEN SICHERHEIT?
I. Klimasicherheit im Realismus - ein Oxymoron?
II. Typologisierung der Bedrohungen
III. Eine US-amerikanische Perspektive
IV. Eine europ ä ische Perspektive
a. Klimawandel und knappe Ressourcen
b. Polit-ökonomische Auswirkungen des Klimawandels
c. Die Rolle menschlicher Sicherheit in der Klimasicherheit
D. ZURÜCK ZUM REALISMUS?
E. SCHLUSSFOLGERUNGEN
LITERATUR