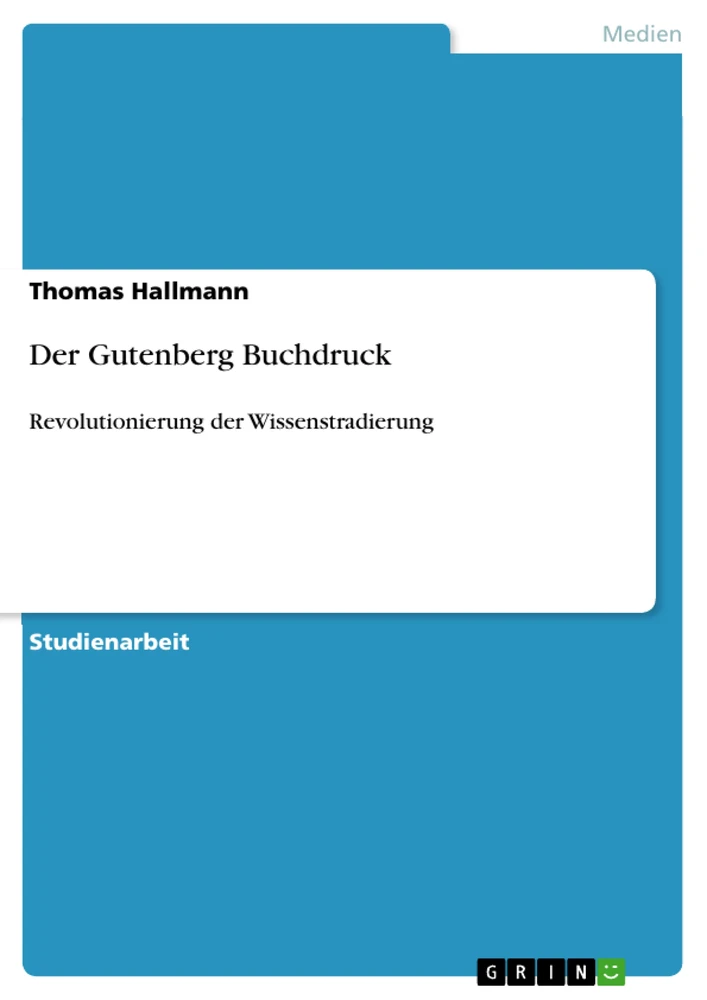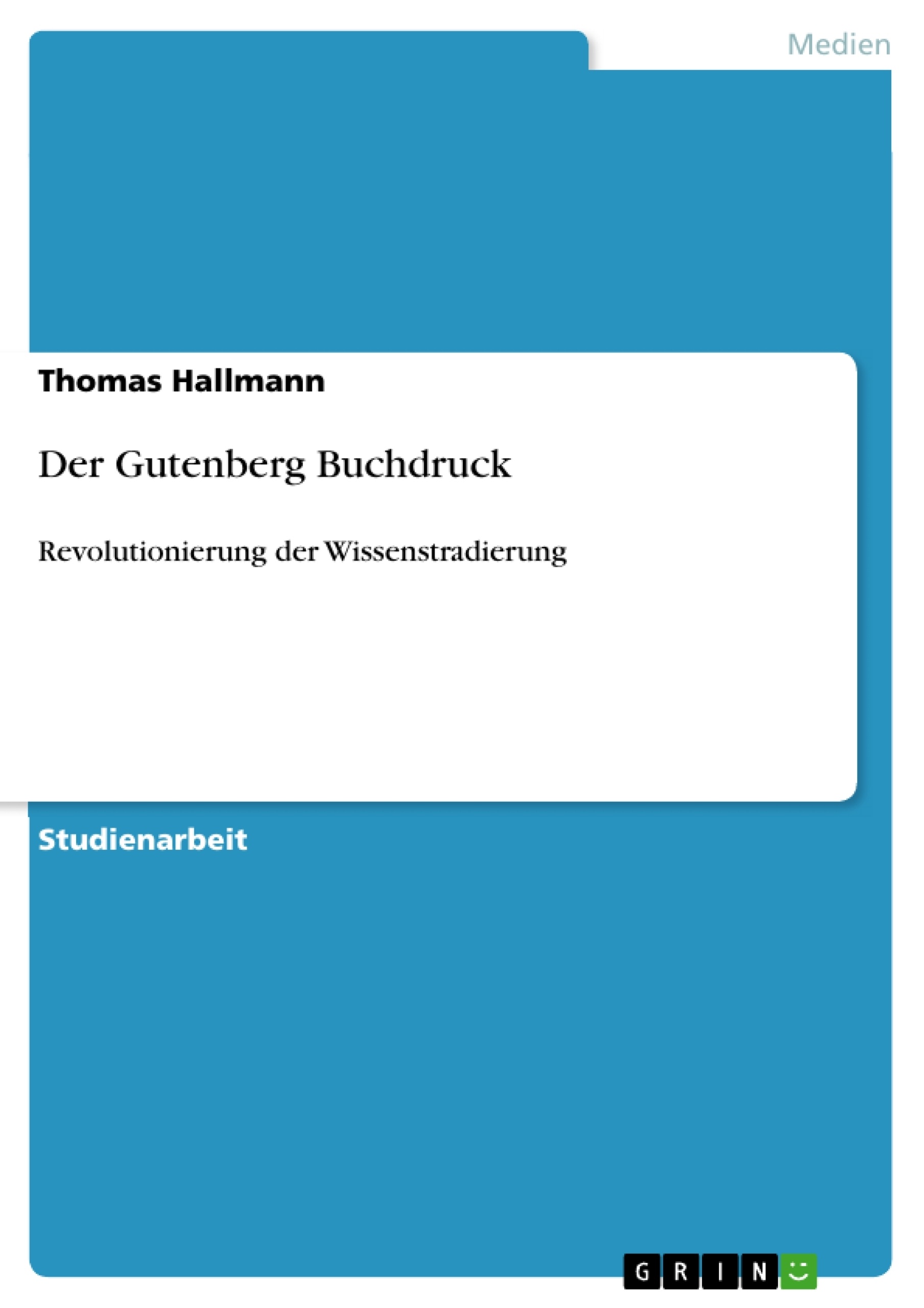Die Einführung des Buchdrucks vor 550 Jahren hatte eine nahezu unvorstellbare Wirkung auf die damalige Feudalgesellschaft. Die Druckkunst Gutenbergs öffnete einer breiten Masse von Menschen den Zugang zum Wissen und durchbrach damit das bisherige Bildungsmonopol der Kirche. Durch die erstaunliche Schnelligkeit, mit der sich das Druckverfahren mit beweglichen Lettern in Europa ausbreitete, wurden naturwissenschaftliche Erkenntnisse sowie neue gesellschaftspolitische Ideen in windes Eile verbreitet. Damit gingen gleichzeitig die Herausbildung eines neuen Öffentlichkeitsbewusstseins und die Entwicklung eines modernen fortschrittlichen Denkens einher. Gutenbergs Druckverfahren hatte nicht nur eine Revolutionierung der Wissenstradierung und der gesellschaftlichen Ordnung sondern auch die Umwälzung der bisherigen Produktionsmethoden zur Folge. Die Vielzahl an Berufen, die mit dem Buchdruck verbunden waren bzw. sich durch ihn herausgebildet hatten, zeichnete sich durch neue technische Verfahren und Arbeitsschritte, die in einer stark differenzierten Arbeitsteilung das Druckerhandwerk umfassten, aus. Die Druckereien führten zur Gründung großer Verlags- und Buchgeschäfte, die die rasche Verbreitung der Literatur erlaubten.
Inhalt
1. Einleitung
2. Wissensvermittlung vor Gutenberg
3. Der Gutenberg Buchdruck
3.1 Die Erfindung des Buchdrucks – Revolutionierung der Wissensvermittlung
3.2 Einführung und Ausbreitung der neuen Informationstechnologie
3.3 Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft
4. Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck
5. Schlussbetrachtung
6. Literatur .