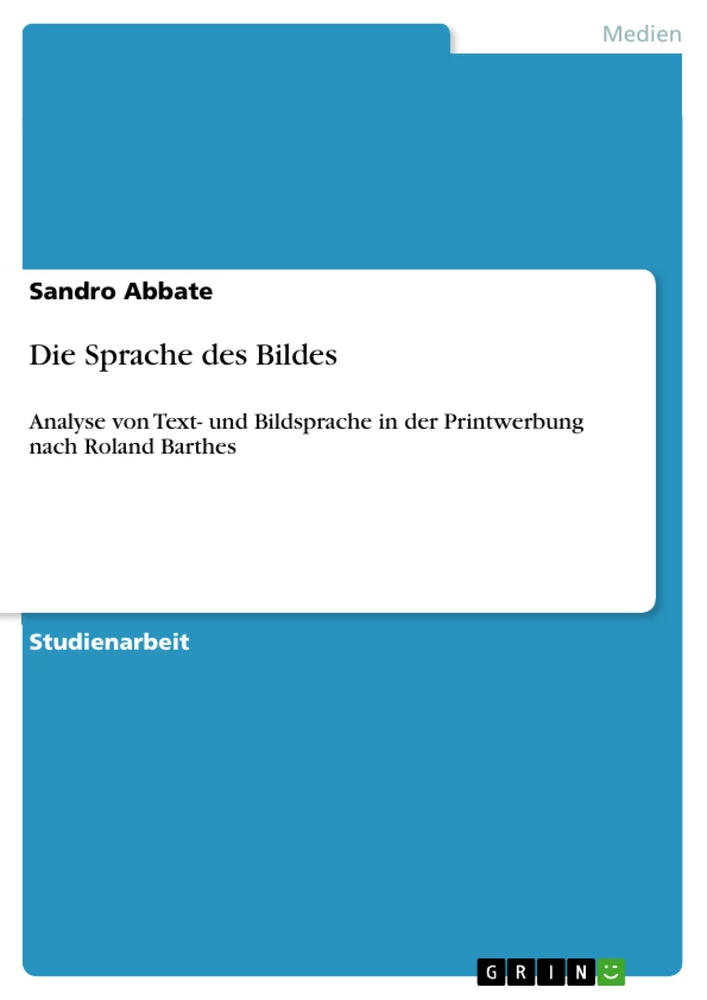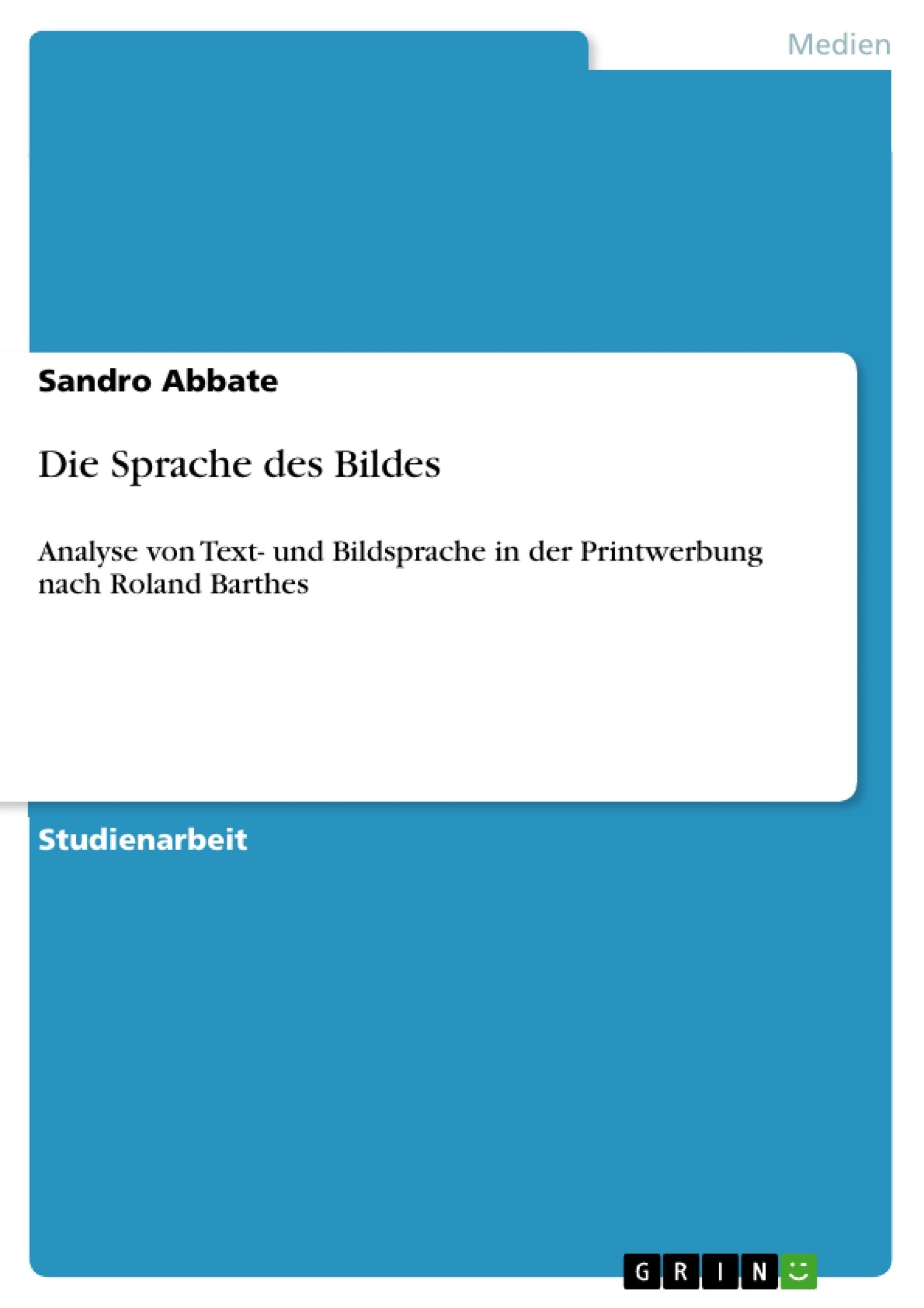Die hier vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der semiotischen Analyse von Werbeanzeigen in Printmedien. Die Werbebranche hat schon seit langem erkannt, welches Potential in der oben beschriebenen zweiten Ebene der Wahrnehmung und der Aussage von Texten liegt. So konzentrierte sich die Werbearbeit immer mehr auf den Aufbau von Marken-Images, das Schaffen von Bedürfnissen und die Vermittlung gewisser Lebensstile, die ein Produkt transportieren soll, statt auf die faktische Anpreisung von Produktvorteilen.
Ausgangspunkt für die Werbeanzeigenanalyse in dieser Arbeit wird der Begriff des Mythos des französischen Philosophen, Schriftstellers und Literaturkritikers Roland Barthes sein, welcher aufzeigt, dass ein Text auf einer sekundären semiologischen Ebene eine Aussage macht, die von der Bedeutung der abgebildeten Objekte – etwa in einer Werbeanzeige – deutlich abweichen kann.
Inhalt
Einleitung
1. Grundlagen der Semiotik
2. Semiotik und Werbung
3. Roland Barthes: Mythen des Alltags und Rhetorik des Bildes
3.1 Objektsprache in der sprachlichen Botschaft
3.2 Objektsprache in der Botschaft des denotierten Bildes
3.3 Metasprache
4. Semiotische Werbeplakatanalyse an zwei Beispielen
Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Nachweis der Werbeanzeigen