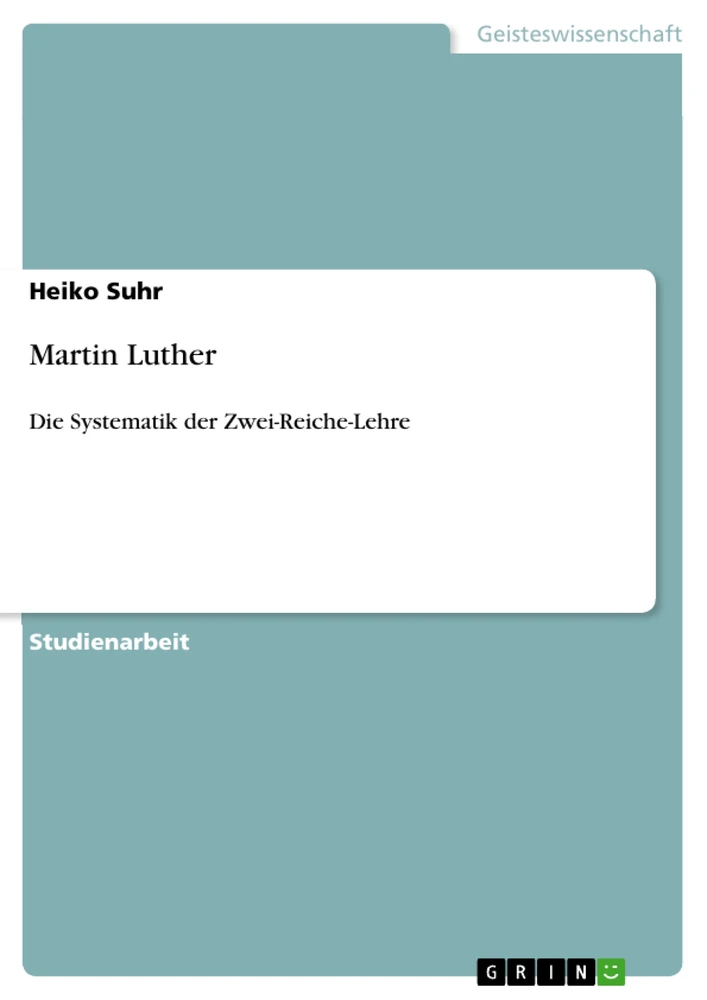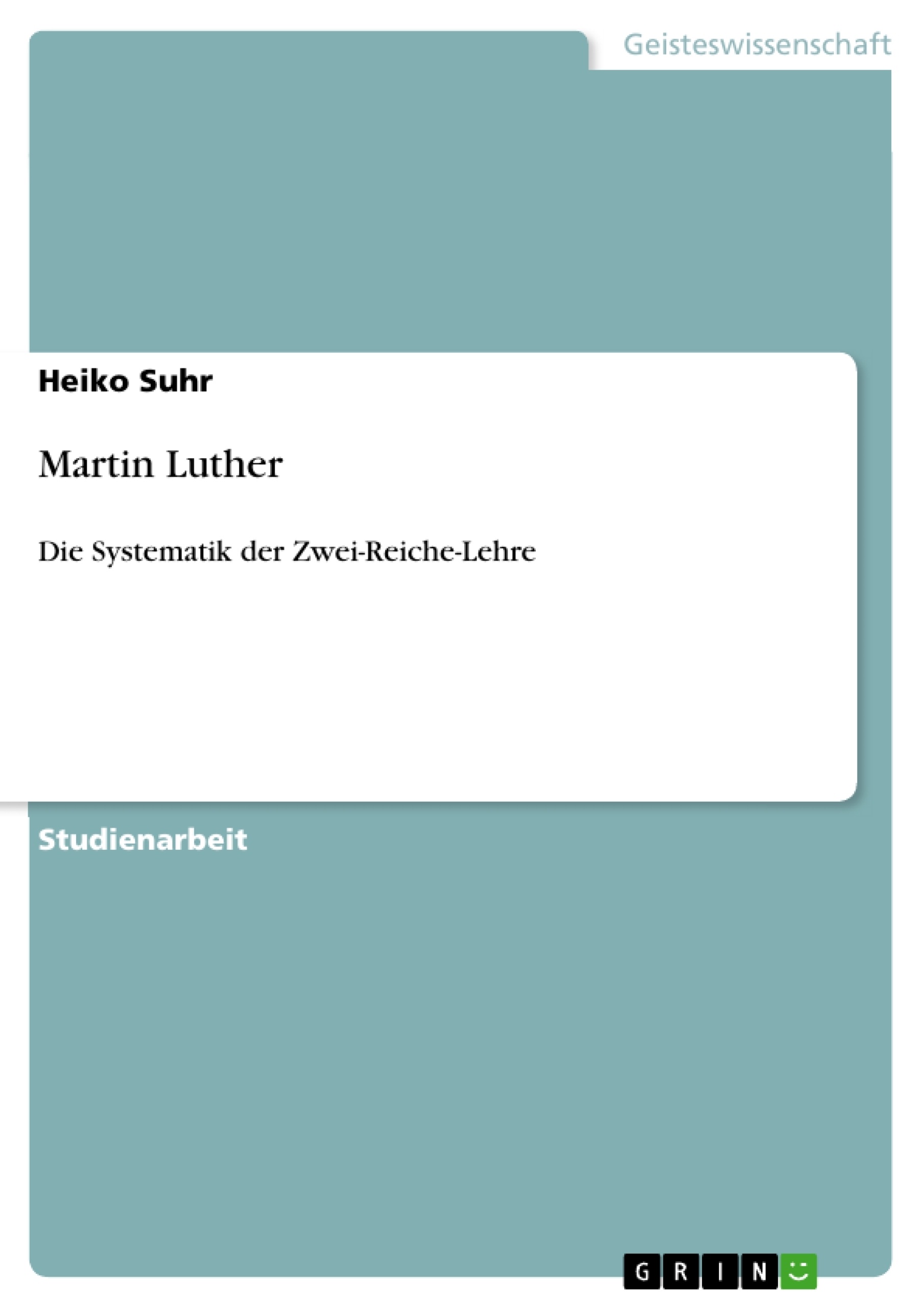Das Thema dieser Hausarbeit ist die Zwei-Reiche-Lehre des Dr. Martin Luther. Dabei ist der Begriff Lehre unscharf, da es sich nicht um eine Systematik im engeren Sinne handelt. Es handelt sich eher um die Summe vieler Schriften, die alle im Bezug zu Fragen der weltlichen Obrigkeit stehen. Zeitlich ist das Thema am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit einzuordnen. Eine allgemeine Emanzipation von göttlicher Ordnung, vor allem durch die aufkommenden Natur- und Geisteswissenschaften, ist zeittypisch. Im Mittelpunkt von Humanismus und Renaissance stand der Begriff der Vernunft. Es ging unter anderem darum, den Staat ohne Gott als weltliche Organisation reiner Zweckdienlichkeit zu legitimieren. In diesem Sinne kann man die Reformation folgerichtig als hermeneutischen Streit um die Auslegung der Bibel deuten. Glaubensfragen wurden nun mit Mitteln der Vernunft beantwortet. Ein Beispiel dafür ist nun die Zwei-Reiche-Lehre. Luthers Modell basiert auf der Erbsünde. Das Paradies war der Normalzustand, nach dem Sündenfall zerfiel die Welt in eine irdische und ein geistliche Ebene. Diese Ordnung ist vorläufig, da am Tage des jüngsten Gerichts die irdische Welt zerstört und die geistliche Welt von Christus an Gott übergeben wird. Es entsteht dann das regnum gloriae. Den Weg dorthin schildert Luther in seiner Zwei-Reiche-Lehre.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Themendarstellung
1.2 Martin Luther und seine Zeit
2. Entstehungsbedingungen der Zwei-Reiche-Lehre
2.1 Historischer Kontext
2.2 Luthers Obrigkeitsschrift
3. Die Systematik der Zwei-Reiche-Lehre
3.1 Augustin: Vom Gottesstaat
3.2 Die Zwei-Reiche-Lehre Martin Luthers
3.3 Der Staat in der Zwei-Reiche-Lehre
4. Luther und das Widerstandsrecht
5. Abschließende Betrachtungen
6. Anhang
6.1 Literaturverzeichnis