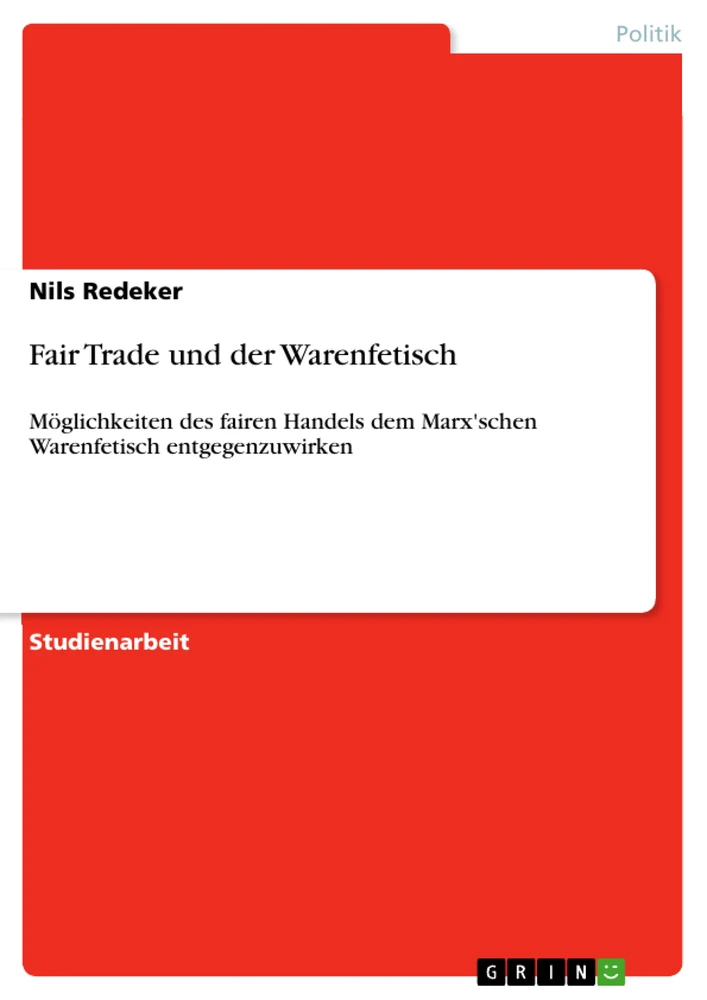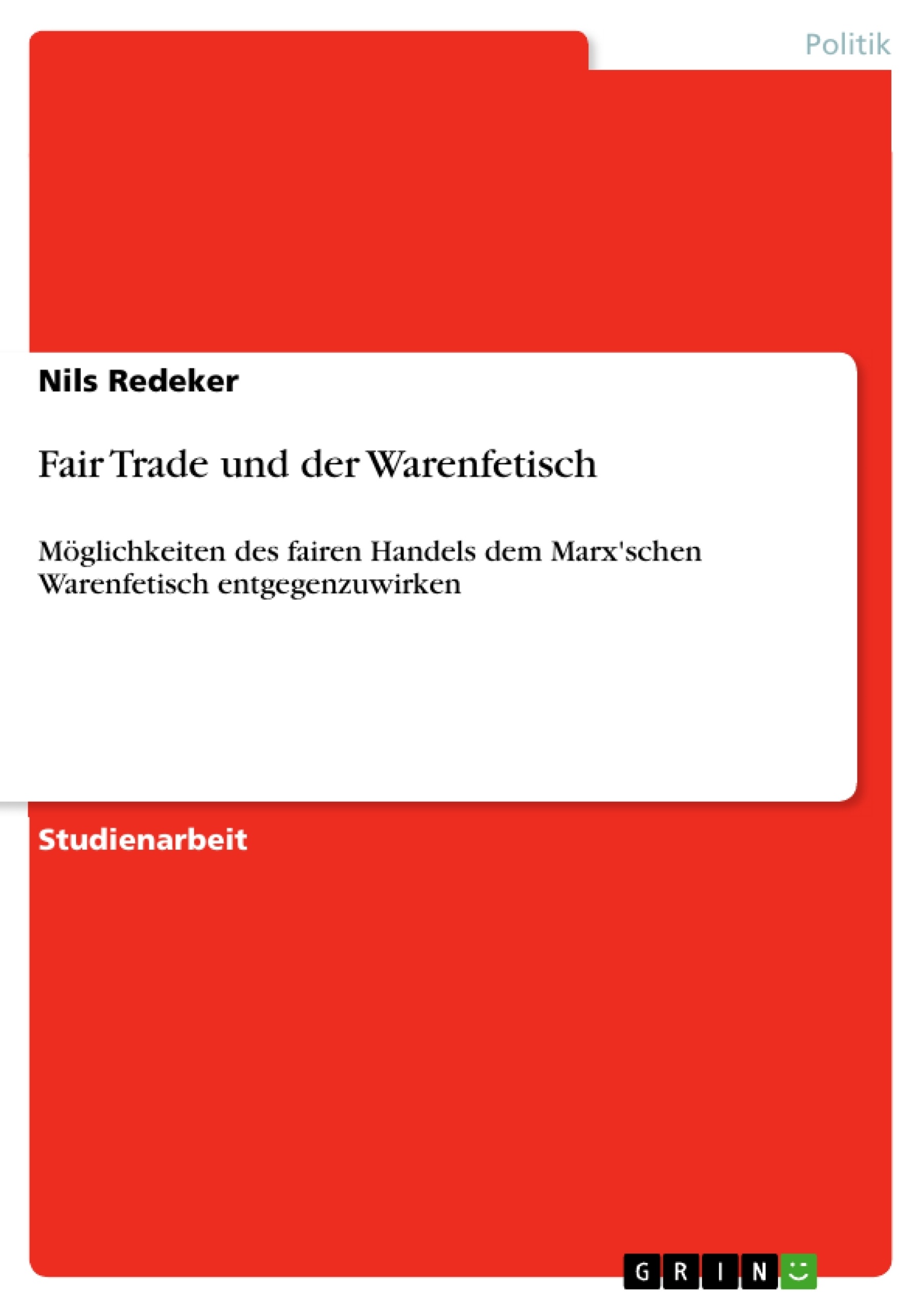Die Fairtrade-Bewegung hat in den letzten zwei Jahrzehnten einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren: starke Zuwachsraten, immer mehr Lebensmittelhändler, die fair gehandelte Produkte führen und ein immer größerer Bekanntheitsgrad des Fairtrade-Siegels sind klar Signale für die Entwicklung des einst belächelten Nischenprodukts. Dabei besteht das Ziel der Bewegung zuallererst in Armutsbekämpfung und der Ermöglichung sozio-ökonomischer Entwicklung von, im Welthandel ansonsten stark benachteiligten, Produzentengruppen im globalen Süden. Allerdings gehen die Erwartungen einiger Beobachter weit über Milderung von Armut hinaus. Vielmehr als der direkte Einfluss auf Löhne und Arbeitsbedingungen im globalen Süden stehen für sie die Potenziale der Fairtrade-Bewegung im Vordergrund, die Grundstrukturen des Kapitalismus selbst herauszufordern. Diese Argumentation ist nahe an das Marx‘sche Konzept des Warenfetisch angelegt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt mit der Frage, inwiefern diese Hoffnung berechtigt ist. Können Fairtrade-Produkte tatsächlich ein angemessenes Mittel sein, dem Fetischcharakter der Ware entgegenzuwirken?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Ware bei Marx
3. Der Warenfetisch
3.1 Versachlichung gesellschaftlicher Beziehungen
3.2 Die Verschleierung des Produktionsprozesses
3.3 Das Machwerk wird zum Machtwerk
4 Fairtrade und der Warenfetisch
4.1 Fairtrade-Produkte und die Versachlichung gesellschaftlicher Beziehungen
4.2 Fairtrade-Produkte und die Verschleierung des Produktionsprozess
4.3 Fairtrade-Produkte und die Kontrolle über die Wertgegenständlichkeit
5. Fazit
6. Bibliografie