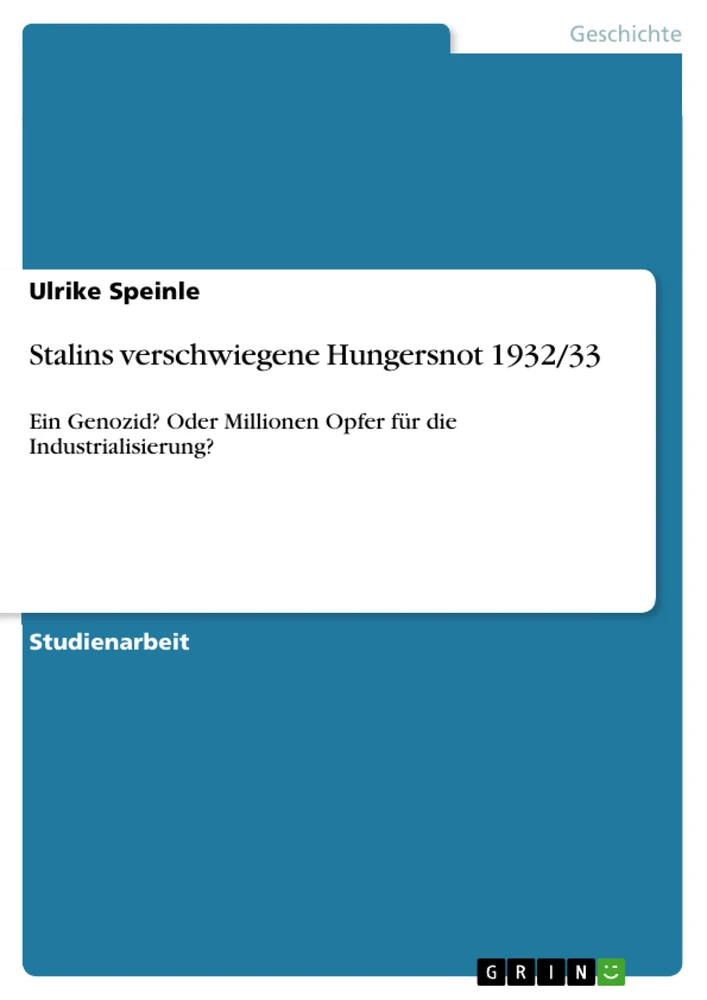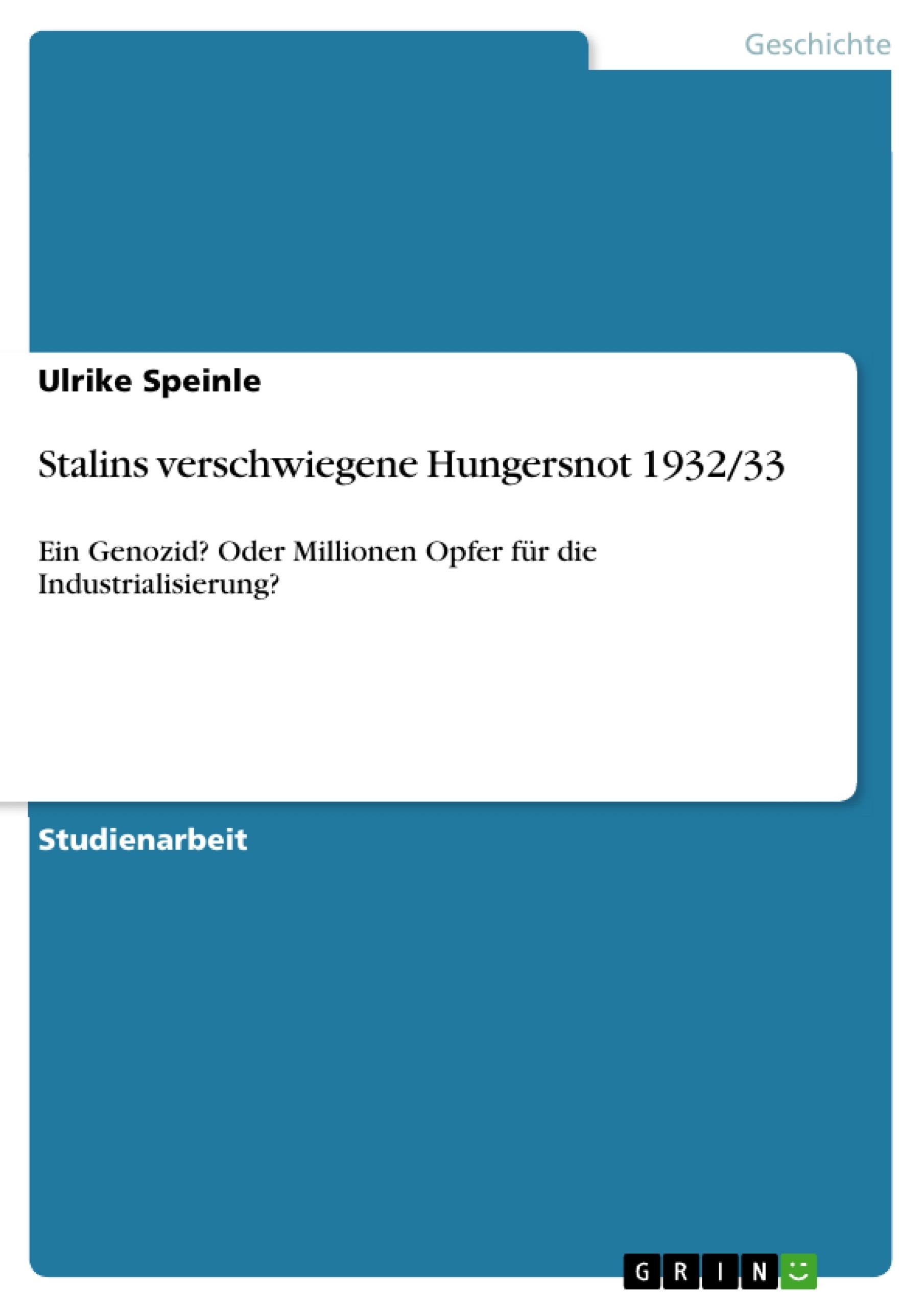Die Hungersnot in der Sowjetunion 1932/33, die im kollektiven Gedächtnis der Ukraine als Holodomor bekannt ist, zählt zu den größten Katastrophen des letzten Jahrhunderts.
Im Zuge der stalinistischen Kollektivierungs- und Industrialisierungspolitik herrschte besonders in den normalerweise getreidereichen Gebieten der Sowjetunion eine Hungersnot, die etwa 6 bis 7 Millionen Menschen das Leben kostete. Exakte Zahlen der Opfer sind bis heute nicht bekannt, da keine Sterbelisten geführt wurden. Das ungefähre Ausmaß lässt sich nur mit zeitnahen Berichten, Volkszählungsergebnissen und über Angaben der Geburten und Sterberaten, Heiratsgewohnheiten oder Abwanderungen bestimmen.
Während die Jahre 1932/33 fast ausschließlich mit Hitlers Machtergreifung und den Anfängen des Nationalsozialismus in Verbindung gebracht werden, ist die Hungerkatastrophe von 1932/33 in der westlichen Geschichtsschreibung noch immer ein weitgehend unbekanntes Thema. Sie ist lange zu Unrecht als „Ereignis bei der Überwindung der Rückständigkeit der kleinbäuerlichen Landwirtschaft“ abgetan worden.
Der ukrainische Ausdruck Holodomor erweckt leicht Assoziationen an den Holocaust. Etymologisch gesehen haben die Bezeichnungen Holodomor und Holocaust jedoch keinen gemeinsamen Ursprung. Während „holod“ bzw. „golod“ und „mor“ im Ukrainischen und Russischen wörtlich übersetzt „Hunger“ und „Seuche“ bedeuten, entspringen „holo“ und „kaustos“ dem Griechischen und bedeuten wörtlich „ganz“ und „verbrannt“. Dennoch wird die Hungersnot von einigen Forschern und Medien gerne als „Stalins Holocaust“ bezeichnet. Ob es sich bei dem Holodomor jedoch um einen Genozid handelte oder ob die Opfer im Zuge der Industrialisierungs- und Kollektivierungspolitik in Kauf genommen wurden, ist Thema dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Einführung
3. Die These vom Genozid am ukrainischen Volk
4. Voraussetzungen zur Hungersnot
4.1 Forcierte Industrialisierung
4.2 Kollektivierung und Getreiderequisitionen
4.3 Getreideerträge und Export
4.4 Der Kulak – Ein Klassenfeind
5. Die Hungerjahre 1932/33
5.1 Hunger in der Kornkammer Russlands
5.2 Desorganisation auf allen Ebenen
5.3 Die Versorgungslage in den Städten
5.4 Terror auf dem Land
6. Die Parteiführung
6.1 Die Rolle Stalins
5.5. Maßnahmen
6.2 Weshalb wurde die Katastrophe geheim gehalten?
7. Mögliche Motive
7.1 Hunger als Waffe zur Auslöschung des ukrainischen Nationalismus?
7.2 Hunger als Folge von Zwangssparprozessen?
8. Bewertung der Industrialisierungs- und Kollektivierungspolitik
9. Fazit
10. Literaturverzeichnis