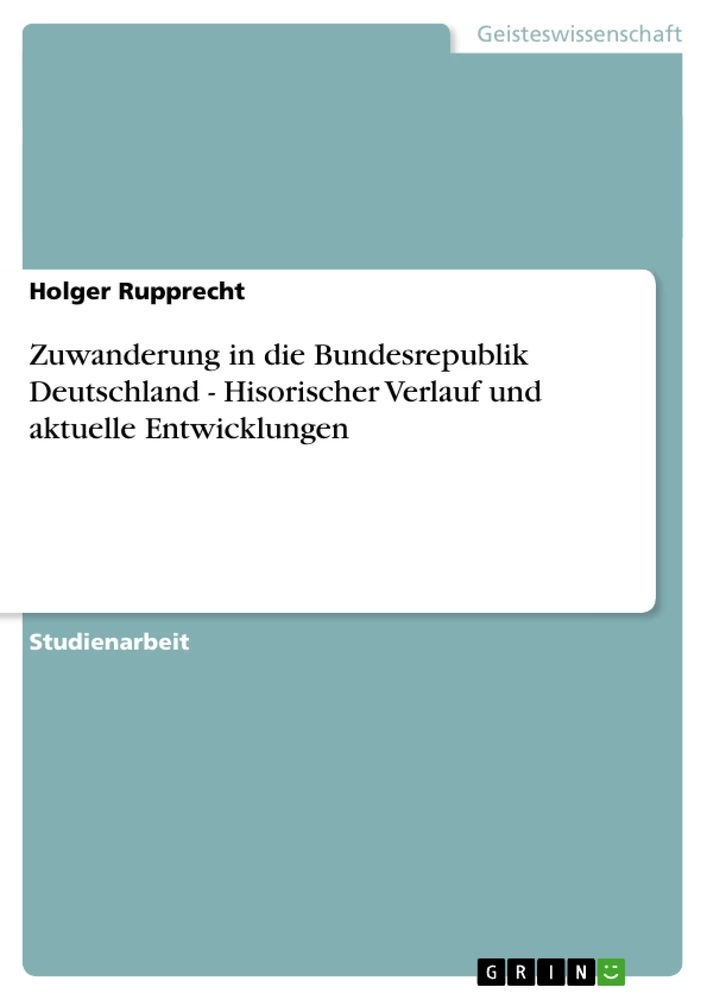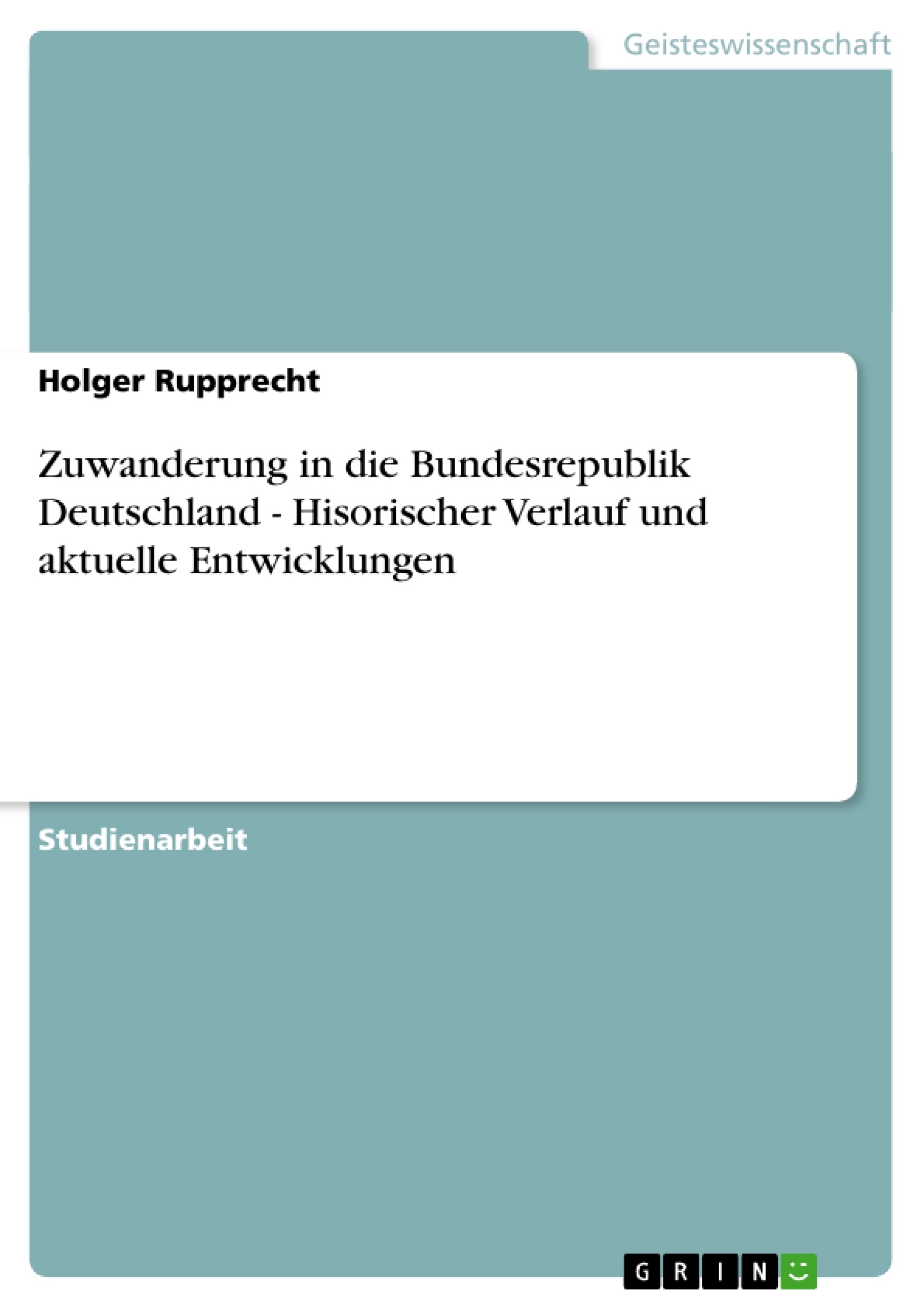Die Geschichte der Bundesrepublik ist eng mit einem äußerst lebhaften Migrationgeschehen verbunden. Insgesamt zogen seit den 1950er Jahren mehr als 30 Millionen Personen ins Land, weitaus die meisten verließen es wieder. Viele aber ließen sich dauerhaft in der Bundesrepublik nieder, die dem zu Folge de facto seit ihrer Gründung ein Einwanderungsland war. 1997 waren von 82 Millionen in der Bundesrepublik wohnhaft Gemeldeten nur rund 66 Millionen Personen im Inland geboren und gleichzeitig immer deutsche Staatsbürger gewesen. Je nach wirtschaftlicher Situation in der Bundesrepublik und der politischen „Großwetterlage“ der Welt wurden diese Personen aus unterschiedlichen Motiven zu unterschiedlichen Bedingungen aufgenommen. Erst in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre aber setzte sich in der politischen Diskussion des Landes die Erkenntnis durch, dass es einer umfassenden Regelung bedarf, um die Migration nach Deutschland und den Aufenthalt der hier lebenden Ausländer regeln und steuern zu können.
Diese Arbeit zielt darauf, Determinanten, Kontroversen und Konzepte bezüglich der Migration in die Bundesrepublik in historischer und aktueller Perspektive zu skizzieren. Flucht und Vertreibung ehemaliger Staatsangehöriger des deutschen Reiches zwischen 1945 und 1949 wird dabei kein Gegenstand der Ausführungen sein, ebenso wenig wie die Übersiedelung von Personen aus der Deutschen Demokratischen Republik zwischen 1949 und 1990.
Geschildert wird im ersten Abschnitt die Migration von ausländischen Arbeitskräften, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern. Den Mittelabschnitt bildet in aller Kürze eine Zusammenfassung des ersten Schrittes in eine neue Richtung der Ausländerpolitik, die Neuregelung des Staatsangehörigkeitsrechts. Der dritte und letzte Teil der Arbeit skizziert das Ringen um ein neues Konzept: die Diskussion um das geplante Zuwanderungsgesetz der Bundesregierung. Die Frage, ob und inwieweit sich die Migranten, die den genannten Gruppen zugerechnet werden in die bundesrepublikanische Aufnahmegesellschaft integrieren konnten, würde allein schon wegen der kontrovers diskutierten Frage, was unter Integration verstanden
werden soll und wie diese gemessen werden kann, den Rahmen dieser Arbeit sprengen und wird somit außen vor gelassen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Migration in die Bundesrepublik Deutschland nach 1949
2.1 Arbeitsmigration
2.1.1 Die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte (1955-1973)
2.1.2 Arbeitsmigration nach 1973
2.1.3 „Neue“ Gastarbeiter
2.2 (Spät-)Aussiedler - Migration von Personen (volks-) deutscher Herkunft
2.3 Flüchtlinge und Asylsuchende
2.4 Illegal Eingewanderte
3 Das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht
4 Die Einwanderungsdebatte: Kontroverse um ein neues Konzept
4.1 Gesetzesentwurf der Bundesregierung
4.2 Kritikpunkte der Union
5 Schluss
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Geschichte der Bundesrepublik ist eng mit einem äußerst lebhaften Migrationgeschehen verbunden. Insgesamt zogen seit den 1950er Jahren mehr als 30 Millionen Personen ins Land, weitaus die meisten verließen es wieder. Viele aber ließen sich dauerhaft in der Bundesrepublik nieder, die dem zu Folge de facto seit ihrer Gründung ein Einwanderungsland war. 1997 waren von 82 Millionen in der Bundesrepublik wohnhaft Gemeldeten nur rund 66 Millionen Personen im Inland geboren und gleichzeitig immer deutsche Staatsbürger gewesen.[1]
Je nach wirtschaftlicher Situation in der Bundesrepublik und der politischen „Großwetterlage“ der Welt wurden diese Personen aus unterschiedlichen Motiven zu unterschiedlichen Bedingungen aufgenommen. Erst in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre aber setzte sich in der politischen Diskussion des Landes die Erkenntnis durch, dass es einer umfassenden Regelung bedarf, um die Migration nach Deutschland und den Aufenthalt der hier lebenden Ausländer regeln und steuern zu können.
Diese Arbeit zielt darauf, Determinanten, Kontroversen und Konzepte bezüglich der Migration in die Bundesrepublik in historischer und aktueller Perspektive zu skizzieren. Flucht und Vertreibung ehemaliger Staatsangehöriger des deutschen Reiches zwischen 1945 und 1949 wird dabei kein Gegenstand der Ausführungen sein, ebenso wenig wie die Übersiedelung von Personen aus der Deutschen Demokratischen Republik zwischen 1949 und 1990.
Geschildert wird im ersten Abschnitt die Migration von ausländischen Arbeitskräften, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern. Den Mittelabschnitt bildet in aller Kürze eine Zusammenfassung des ersten Schrittes in eine neue Richtung der Ausländerpolitik, die Neuregelung des StaatsangehörigkeitsrechtS. Der dritte und letzte Teil der Arbeit skizziert das Ringen um ein neues Konzept: die Diskussion um das geplante Zuwanderungsgesetz der Bundesregierung. Die Frage, ob und inwieweit sich die Migranten, die den genannten Gruppen zugerechnet werden in die bundesrepublikanische Aufnahmegesellschaft integrieren konnten, würde allein schon wegen der kontrovers diskutierten Frage, was unter Integration verstanden werden soll und wie diese gemessen werden kann, den Rahmen dieser Arbeit sprengen und wird somit außen vor gelassen.
2. Migration in die Bundesrepublik Deutschland nach 1949
2.1. Arbeitsmigration
In Folge der prosperierenden bundesdeutschen Wirtschaft in den 1950er Jahren, herrschte in einigen Industriezweigen bestimmter Regionen ein beträchtliches Defizit an Arbeitskräften. In der Diskussion, wie dieses Defizit zu beseitigen sei, setzte sich der Vorschlag durch, im südeuropäischen und nordafrikanischen Ausland Arbeitskräfte für einen temporär begrenzten Arbeitsaufenthalt in der Bundesrepublik zu rekrutieren.
2.1.1. Die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte (1955-1973)
Zwischen 1955 und 1968 wurden bilaterale Anwerbeverträge mit Italien (1955), Spanien (1960), Griechenland (1960), der Türkei (1961), Marokko(1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968) abgeschlossen. Deutsche Unternehmen meldeten bei der Bundesanstalt für Arbeit Bedarf an, woraufhin diese über Außenstellen in den genannten südeuropäischen bzw. nordafrikanischen Staaten mittels eines mitunter fragwürdigen Auswahlverfahrens[2] die passenden Arbeitskräfte rekrutierte. Geplant war, die Arbeitnehmer im Sinne eines Rotationsmodells nach kurzer Zeit wieder auszuwechseln. Die Arbeitserlaubnis wurde nur für einen bestimmten Arbeitsplatz in einem bestimmten Unternehmen erteilt. Der Gewinn für die deutsche Wirtschaft war enorm.[3] „Der größte Vorteil der Ausländer für die deutsche Wirtschaft [bestand, H.R. ] in ihrer Funktion als mobile Reservearmee des westdeutschen Arbeitsmarktes (...).[4] Die ausländischen Arbeit-nehmer ermöglich(t)en den deutschen Arbeitnehmern soziale Aufstiegschancen, da sie die unteren und untersten Plätze der Beschäftigungshierarchie einnahmen. Sie kamen physisch und psychisch gesund im besten Arbeitsalter zwischen 18 und 45, die Kosten für Schulbildung und beruflicher Ausbildung wurden vom Heimatland getragen, sie konnten sehr mobil innerhalb Deutschland in den jeweiligen Wachstumsbranchen eingesetzt werden, bremsten die Lohnentwicklung im Billiglohnsektor und zahlten mehr in staatliche wie innerbetriebliche Sozialkassen ein, als sie ihrerseits in Anspruch nahmen.
„Über alle politischen Lager hinweg herrschte die Auffassung vor, die Anwesenheit von Ausländern sei ein Übergangsproblem, das sich mit der Zeit von selbst lösen werde.“[5] Doch die Unternehmen beklagten schon bald teuere Anlernzeiten, die sich in Folge des Rotationsmodells ergaben. Die ausländischen Arbeitnehmer wollten aus finanziellen Gründen möglichst lange in der Bundesrepublik bleiben und ein menschenwürdigeres Leben führen, als es ihnen bisher, getrennt von ihrer Familie, meist in Wohnheimen untergebracht, vergönnt war. Daher erwies sich die „Vorstellung vom >Gastarbeiter<, der einige Jahre im Inland arbeitet und anschließend zu seiner Familie ins Ausland zurückkehrt, (...) schon in den 1960er Jahren als Trugbild.“[6] Dennoch kehrten vor dem Anwerbestopp 1973 die Mehrzahl der angeworbenen Arbeitskräfte der ersten Generation wieder in ihr Heimatland zurück, in erster Linie ging es ihnen nicht darum, „im Anwerbeland eine Existenz aufzubauen, sondern in der Heimat für sich und ihre Familienangehörigen eine Existenz erst zu ermöglichen.“[7].
2.1.2. Arbeitsmigration nach 1973
Im November 1973 wurde bedingt durch die weltweite Rezession in Folge der Ölkrise und der damit verbundenen steigenden Arbeitslosigkeit ein Anwerbestopp verfügt, der, trotz weitreichender Ausnahmeregelungen (siehe 2.1.3), bis heute Bestand hat. Damit trat die bundesdeutsche Arbeitsmigration in die Phase der Konsolidierung. Im Mittelpunkt standen von nun an Überlegungen zur:
- Zuwanderungsbegrenzung
- sozialen Integration auf Zeit
- Rückkehrförderung (seit Anfang der 80er Jahre)
In den Rezessionsjahren 1974-1977 gab es erstmals nach 1955 wieder ein negatives Wanderungssaldo, davon abgesehen stieg die ausländische Wohnbevölkerung aber kontinuierlich an. Der Anwerbestopp wurde somit:
„zu einem Bumerang in der Ausländerpolitik (...): Er blockierte zwar den weiteren Arbeitskräftezustrom. Bei der schon ansässigen Ausländerbevölkerung aber beendete er die ohnehin abnehmende Fluktuation von ‚Gastarbeitern‘ zwischen Bundesrepublik und Herkunftsländern; denn nun konnte aus freiwilliger Rückkehr auf Zeit ein unfreiwilliger Abschied für immer werden. Viele blieben aus diesem Grund und zogen ihre Familien nach.“[8]
In welcher Zahl Personen durch Regelungen des Familiennachzuges in die Bundesrepublik kamen ist nicht bekannt, dennoch gehen Schätzungen davon aus, dass in den späten 1970er und 1980er Jahren mehr als die Hälfte der Zuwanderer durch Familiennachzug ins Land kamen.[9]
Viele ausländische Arbeitnehmer sahen sich wegen der hohen Lebenshaltungskosten in der Bundesrepublik mit der Tatsache konfrontiert, dass das Vorhaben, genug Geld für eine gesicherte Existenz im Heimatland bei Seite zu legen, trotz des höheren Lohnniveaus scheiterte. Je länger sie in der Bundesrepublik blieben, desto schwieriger wurde die angestrebte Rückkehr. Die Heimatländer blieben nicht so, wie sie in der Erinnerung waren, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse änderten sich oft fundamental. Manchem wurde die alte Heimat fremder als die Bundesrepublik. Diese Faktoren verstärkten die Tendenz, sich dauerhaft in der Bundesrepublik niederzulassen.
Im öffentlichen Sprachgebrauch löste der Begriff „ausländische Arbeitnehmer“ nach und nach den Begriff „Gastarbeiter“ ab.[10] Auch in der Politik setzte sich langsam die Erkenntnis durch, dass der sozialen Realität einer ausländischen Wohnbevölkerung in Millionenhöhe Rechnung getragen werden müsse. Aus diesem Grund wurde 1978 erstmals ein „Beauftragter der Bundesregierung für die Integration ausländischer Arbeitnehmer und ihrer Familien“ berufen, Heinz Kühn von der SPD, der 1981 durch Lieselotte Funcke von der FDP abgelöst wurde. Dennoch wurde eine „Integrationspolitik (...) nur in Ansätzen, nicht jedoch in Form eines überfälligen Einwanderungsgesetzes entwickelt.“[11]
Nach der „Wende“ in Bonn verfolgte die CDU/CSU/FDP Koalition klar das Ziel der Migrationseindämmung. „Die Gesetzesvorlagen der 80er und 90er Jahre machten deutlich, dass es sich bei der ‘Integrationsphase’ nur um ein Intermezzo handelte. Die Ausländerpolitik wurde danach noch restriktiver.“[12]
1983 wurde das „Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern“, das arbeitslosen Arbeitsmigranten und deren Familien aus den ehemaligen Anwerbestaaten finanzielle Anreize bot, um sie zur Rückkehr in ihre Heimat zu bewegen. So wurde ihnen beispielsweise der Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenversicherung ausgezahlt. Jedoch nahmen nur etwa 250.000 Migranten das Angebot an, wobei zusätzlich klar ist, dass viele nach bekannt werden der Pläne der christlich-liberalen Koalition den Zeitpunkt ihrer Heimkehr verschoben, um noch in den Genuss der Rückkehrförderung zu kommen.
Norbert Wenning konstatiert für die Phase nach 1990:
„Weiterhin hat sich die bundesdeutsche Migrationspolitik seit 1990 in ihrer tendenziellen Abwehrhaltung massiv verstärkt (...). Das neue Ausländergesetz vom 9.Juli 1990, das 1991 in Kraft trat, ist nach wie vor ein ‚Ausländerabwehrgesetz‘. Die Weigerung der Bundesregierung Kohl, Migrations- und Integrationspolitik verstärkt in den politischen Handlungsrahmen einzubeziehen und höher zu bewerten, veranlaßte die damalige Ausländerbeauftragte Liselotte Funcke, im Juli 1991 zurückzutreten.“[13]
Als Nachfolgerin konnte die Koalition erst Monate später Cornelia Schmalz-Jacobsen von der FDP präsentieren, die das Amt bis 1998 inne hatte und nach der Bundestagswahl 1998 von Marieluise Beck von Bündnis 90/Die Grünen „beerbt“ wurde. Auch nach der Bundestagswahl 2002 führt sie dieses Amt weiter, seit Oktober 2002 jedoch unter der Bezeichnung „Bundesbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration.
2.1.3. „Neue“ Gastarbeiter
Seit Ende der 80er bzw. besonders seit Anfang der 90er sprechen einige Autoren[14] vom Beginn einer „neuen“ Gastarbeiterpolitik. Durch die so genannte Anwerbestoppausnahmeverordnung von 1990 ist es ausländischen Arbeitnehmern vor allem aus mittel- und osteuropäischen Ländern möglich, zu bestimmten Bedingungen eine Arbeitsstelle in der Bundesrepublik anzutreten. Die genauen Konditionen sind in Verträgen zwischen den deutschen Arbeitsbehörden und den Herkunftsländern geregelt. Es existieren verschiedene Modelle, die den ausländischen Arbeitnehmern erlauben, einen jeweils unterschiedlichen Status einzunehmen.
Zu den Modellen im Einzelnen:
Werkvertragsarbeitnehmer
Ausländische Firmen, die ihren Sitz nicht im EU-Raum haben, können, wenn sie mit deutschen Firmen zusammenarbeiten, Aufträge in der Bundesrepublik auch von eigenen Arbeitnehmern durchführen lassen. Der Lohn orientiert sich dabei, zumindest offiziell, am deutschen Lohnniveau. Stammen die Firmen aus der EU, ist ihnen freigestellt, ob sie deutsche oder ihre „eigenen“ Arbeitnehmer in der Bundesrepublik beschäftigen.
- Gastarbeitnehmer
Mit dieser Regelung können junge Fachkräfte entsprechend länderspezifischer Kontingente in die Bundesrepublik geholt werden. Ihre Rekrutierung ist nicht an eine Prüfung des deutschen Arbeitsmarktes gebunden, sie erhalten in der Regel eine Arbeitserlaubnis für ein Jahr. Das Interesse der deutschen Wirtschaft, diese Regelung in Anspruch zu nehmen, hielt sich jedoch bisher in sehr engen Grenzen.
- Saisonarbeiter
Seit Anfang 1991 können ausländische Arbeitskräfte eine Arbeitserlaubnis für bis zu drei Monaten erhalten. Voraussetzung ist, dass von einem deutschen Unternehmen Bedarf angemeldet wird. Auch hier müssen offiziell die gleichen Löhne gezahlt werden, wie für deutsche Arbeitskräfte, was aber kaum zu kontrollieren ist. Neun von zehn auf diesem Weg in die Bundesrepublik gekommenen Arbeitnehmer sind Polen. 1995 arbeiteten 90 Prozent der Saisonarbeiter in der Land- bzw. Forstwirtschaft und im Weinbau. Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Gruppe ausländischer Arbeitnehmer für die deutschen Betriebe ist enorm. „Ohne Personal aus dem Ausland könnten viele Agrarbetriebe dicht machen (...). (...). Manche rackern sich schon für acht Mark auf dem Feld ab.“[15] Inzwischen dürften die Löhne sich auf etwa fünf Euro pro Stunde belaufen. Versuche, deutsche Arbeitslosenhilfeempfänger in großem Stil zur äußerst anstrengenden Arbeit auf den Feldern zu bewegen, sind gescheitert. In Anbetracht der geringen Stundenlöhne sind kaum deutsche Arbeitnehmer zu finden.
[...]
[1] Vgl. Münz/Ullrich, 2000, S. 17
[2] vgl. Treibel, 1999, S. 117
[3] Vgl. Treibel, 1999, S. 117 ff.
[4] Herbert, 2001, S. 211
[5] Santel/Weber, 2000, S. 111
[6] Santel/Weber, 2000, S. 111
[7] Treibel, S. 151
[8] Bade, 1994, S. 45f.
[9] Münz/Ullrich, 2000, S. 32
[10] vgl.Klärner, 2000, S. 53
[11] Treibel, 1999, S. 59
[12] Treibel, 1999, S. 61
[13] Wenning, 1996, S. 156
[14] Rudolph, 1996, S. 160 f.
[15] Rollmann, 2001, S. 6