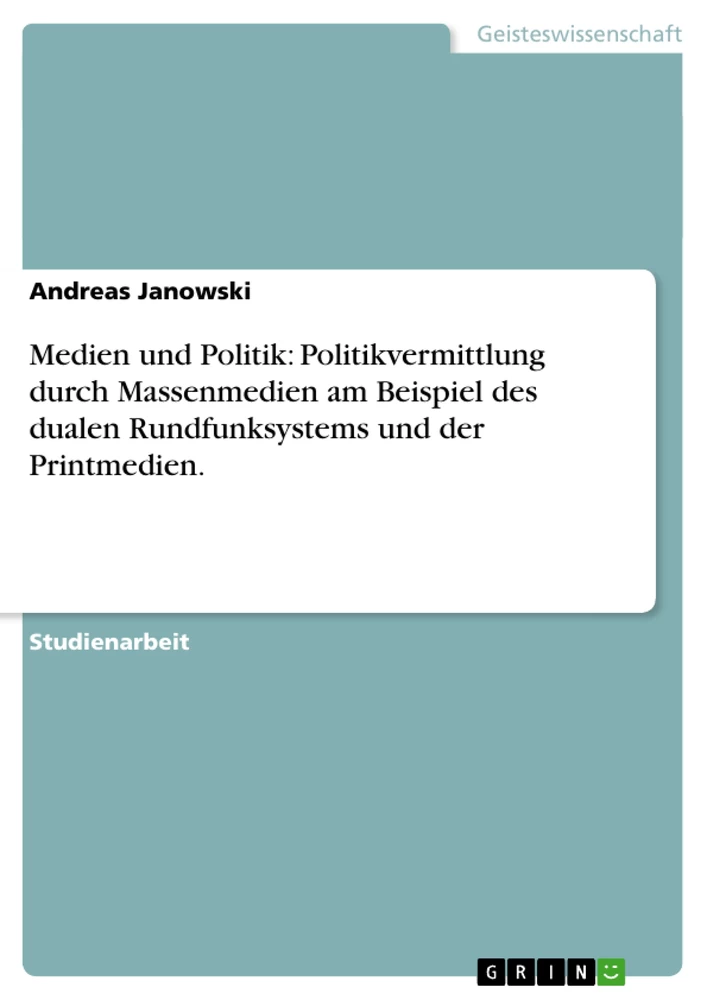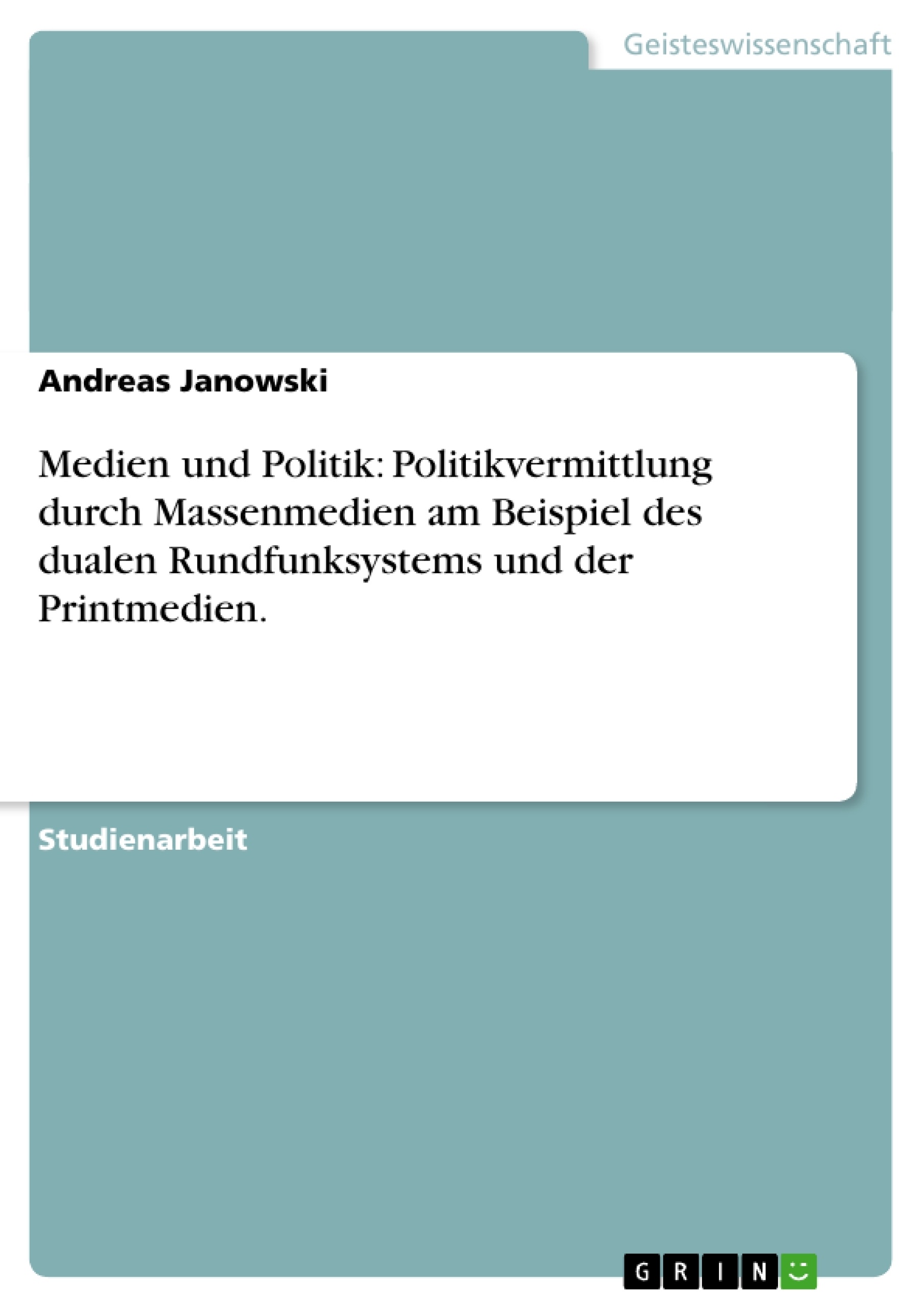Politisches Interesse gehört heutzutage in fast allen sozialen Schichten zum guten Ton, sei es aus beruflichen Gründen, aus privatem Interesse oder einfach nur aus dem Grund, über das politische Geschehen im eigenen Land beziehungsweise auf der ganzen Welt informiert zu sein, und somit auch die Zusammenhänge der Politik zu verstehen. Dabei bedienen sich die politisch Interessierten meist der Massenmedien, die als Vermittler von Politik fungieren. Wie die Massenmedien mit dieser Rolle als Vermittlungsinstanz umgehen und wie Politikvermittlung funktioniert, soll im folgenden erläutert werden.
Im ersten Teil soll zunächst einmal das Verhältnis von Politik und Medien beleuchtet werden. Es werden zwei Thesen vorgestellt, die Dependenzthese und die Instrumentalisierungsthese. Wie Politikvermittlung durch die Medien geschieht beziehungsweise funktioniert, wird im Punkt 3 dargestellt. Zunächst wird dabei auf die massenmediale Politikvermittlung im Allgemeinen eingegangen. Auch der Frage zur Notwendigkeit der Politikvermittlung wird an dieser Stelle nachgegangen.
Den Hauptteil der Arbeit bildet dann die Betrachtung zweier Massenmedientypen: dem Fernsehen und den Printmedien. Bei der Betrachtung des Massenmediums Fernsehen, wird zunächst auf das duale Rundfunksystem eingegangen, bevor an zwei Beispielen versucht wird aufzuzeigen, wie Politik durch das Fernsehen vermittelt wird. Bei der Analyse der Politikvermittlung durch Printmedien werden nach einer allgemeinen Betrachtung ebenfalls zwei Beispiele vorgestellt um den Politikvermittlungsprozess zu erläutern. Zur Literaturlage ist zu sagen, dass das Thema der Politikvermittlung durch Massenmedien zwar häufig Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen ist, man diese aber zum Großteil nicht mehr als aktuell bezeichnen kann. Daher beschränkt sich diese Arbeit auf die wenigen aktuellen Quellen zu diesem Thema.
Gliederung:
1. Einleitung
2. Zum Verhältnis von Politik und Medien
3. Politikvermittlung durch Massenmedien
3.1 Politikvermittlung durch das Fernsehen
3.1.1 Das duale Rundfunksystem
3.1.2 Nachrichtensendungen und –magazine
3.1.3 Politische Magazine und Infotainment
3.2 Politikvermittlung durch Printmedien
3.2.1 Überregionale Qualitätszeitungen
3.2.2 Politische Wochenzeitungen
4. Fazit
5. Literaturliste
1. Einleitung
Politisches Interesse gehört heutzutage in fast allen sozialen Schichten zum guten Ton, sei es aus beruflichen Gründen, aus privatem Interesse oder einfach nur aus dem Grund, über das politische Geschehen im eigenen Land beziehungsweise auf der ganzen Welt informiert zu sein, und somit auch die Zusammenhänge der Politik zu verstehen. Dabei bedienen sich die politisch Interessierten meist der Massenmedien, die als Vermittler von Politik fungieren. Wie die Massenmedien mit dieser Rolle als Vermittlungsinstanz umgehen und wie Politikvermittlung funktioniert, soll im folgenden erläutert werden.
Im ersten Teil soll zunächst einmal das Verhältnis von Politik und Medien beleuchtet werden. Es werden zwei Thesen vorgestellt, die Dependenzthese und die Instrumentalisierungsthese.
Wie Politikvermittlung durch die Medien geschieht beziehungsweise funktioniert, wird im Punkt 3 dargestellt. Zunächst wird dabei auf die massenmediale Politikvermittlung im Allgemeinen eingegangen. Auch der Frage zur Notwendigkeit der Politikvermittlung wird an dieser Stelle nachgegangen.
Den Hauptteil der Arbeit bildet dann die Betrachtung zweier Massenmedientypen: dem Fernsehen und den Printmedien. Bei der Betrachtung des Massenmediums Fernsehen, wird zunächst auf das duale Rundfunksystem eingegangen, bevor an zwei Beispielen versucht wird aufzuzeigen, wie Politik durch das Fernsehen vermittelt wird. Bei der Analyse der Politikvermittlung durch Printmedien werden nach einer allgemeinen Betrachtung ebenfalls zwei Beispiele vorgestellt um den Politikvermittlungsprozess zu erläutern.
Zur Literaturlage ist zu sagen, dass das Thema der Politikvermittlung durch Massenmedien zwar häufig Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen ist, man diese aber zum Großteil nicht mehr als aktuell bezeichnen kann. Daher beschränkt sich diese Arbeit auf die wenigen aktuellen Quellen zu diesem Thema.
2. Zum Verhältnis von Politik und Medien
Um zu erläutern, wie Politik durch Medien vermittelt wird, ist es von Vorteil, zunächst auf das Verhältnis beider zueinander einzugehen. Eine verbreitete Vorstellung ist, dass es zwischen (Massen-) Medien und Politik ein Verhältnis der Über- und Unterordnung gibt. Im wissenschaftlichen Diskurs werden zwei Grundpositionen unterschieden, die Dependenzthese einerseits und die Instrumentalisierungsthese andererseits. Da beide Thesen von unterschiedlichen Beobachtungen und Voraussetzungen ausgehen, gelangen sie auch zu unterschiedlichen Diagnosen.
Die Dependenzthese behauptet, dass die Politik in die Abhängigkeit der Massenmedien geraten ist. Ihre Vertreter weisen der Autonomie und Funktionssicherung politischer Institutionen einen hohen Stellenwert zu. Sie erwarten von den Massenmedien eine dienende Rolle gegenüber Regierung, Parlament und Verwaltung und sehen sie als Vehikel für Informationen, als Forum für politische Akteure und als Spiegel für die öffentliche Meinung. (vgl. Schulz 1997, S. 24) Laut Kepplinger hat sich dieses Verhältnis aber inzwischen umgekehrt. Seiner Meinung nach sind die politischen Institutionen von den Massenmedien abhängig geworden. Diese Situation kann historisch als relativ neu gesehen werden. Während im Absolutismus das auf Geheimhaltung aufgebaute politische System gegenüber der Presse weitgehend autark war, gewann das Prinzip der Öffentlichkeit im Laufe des 19. Jahrhunderts zwar an Bedeutung, aber Regierung, Parlament und Parteien hatten ihren eigenen Zugang zum Volk und sahen die Presse daher nur als reines Übermittlungsorgan. Folgt man der Dependenzthese, so sind in den parlamentarischen Demokratien des 20. Jahrhunderts die politischen Institutionen nicht nur abhängig von den Vermittlungsleistungen der Massenmedien geworden, es haben darüber hinaus zunehmend Grenzverschiebungen und Machtverlagerungen zugunsten der Massenmedien stattgefunden. (vgl. Schulz 1997, S. 25-27)
Die Instrumentalisierungsthese hingegen besagt, dass eine Abhängigkeit der Medien von der Politik existiert. Vertreter dieser Auffassung weisen der Autonomie der Massenmedien einen hohen Rang zu und verlangen von ihnen, dass sie aktiv die Interessen der Bevölkerung artikulieren, die Machtpositionen kritisieren und kontrollieren und, dass sie die Bürger umfassend informieren, damit die Voraussetzung für eine rationale politische Meinungs- und Willensbildung gegeben ist. Folgt man den Ansichten von Schatz, haben wir es mit einem zunehmenden Autonomieverlust der Massenmedien, „als Resultat von Instrumentalisierungsstrategien des politisch-administrativen Systems (...) zu tun“ (Schulz 1997, S. 25) Diese versuchen, Leistungsdefizite staatlicher Politik durch eine bessere Kontrolle des von „den Massenmedien definierten Themen- und Problemhaushalts und durch Sicherung von Massenloyalität durch politische Public Relations zu kompensieren“ (Schulz 1997, S. 25)
Trotz dieser gegensätzlichen und überspitzten Thesen mit ihren Auffassungen über starke und schwache Medien, lassen sich für beide Sichtweisen eine Fülle an empirischen Belegen anbringen. Daher kann man beiden Thesen durchaus einen gewissen Realitätsgehalt zuerkennen. Fakt ist, dass die staatliche Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Privileg ausgestattet ist, mehrheitlich getroffene Wertentscheidungen auch mit physischem Zwang durchzusetzen. Auf der anderen Seite wird den Massenmedien vom Grundgesetz ein Höchstmaß an Autonomie zugestanden. Für das Bundesverfassungsgericht ist „ eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse (...) ein Wesenselement des freiheitlichen Staates (...)“ (Schulz 19997, S. 26) und somit unentbehrlich für eine moderne Demokratie.
3. Politikvermittlung durch Massenmedien
Es gehört zu einer Grundtatsache unserer modernen und hochgradig funktional differenzierten Gesellschaft, dass die Politik ein erfahrungsferner Sektor des gesellschaftlichen Handelns ist. Daher ist es für den normalen Bürger meist nicht möglich, Politik – mit all ihren Voraussetzungen und Wirkungen – zu verstehen. Somit muss er sich Vermittlungsinstanzen bedienen, aus denen heraus ihm mit mehr oder weniger großer Intensität und Regelmäßigkeit politische Botschaften zufließen. Diese, für den Bürger unverzichtbare, Vermittlungsfunktion überbrückt „die Kluft zwischen der Mikroebene des Individuums in seinen alltäglichen Lebenszusammenhängen und der Makroebene des politischen Systems, in dem verbindliche Entscheidungen getroffen werden, die für die ganze Gesellschaft konsequentreich sind.“ (Schmitt-Beck 1994, S. 159-161) Relevant für die Politikvermittlung zwischen dem politischen System und den Bürgern sind in erster Linie zwei Arten von Kommunikationskanälen: zum einen das sogenannte System der Massenmedien, also die verschiedenen Printmedien und elektronischen Medien, andererseits die Netzwerke interpersoneller Kommunikation, beispielsweise mit Freunden, Arbeitskollegen oder Familienmitgliedern.
[...]