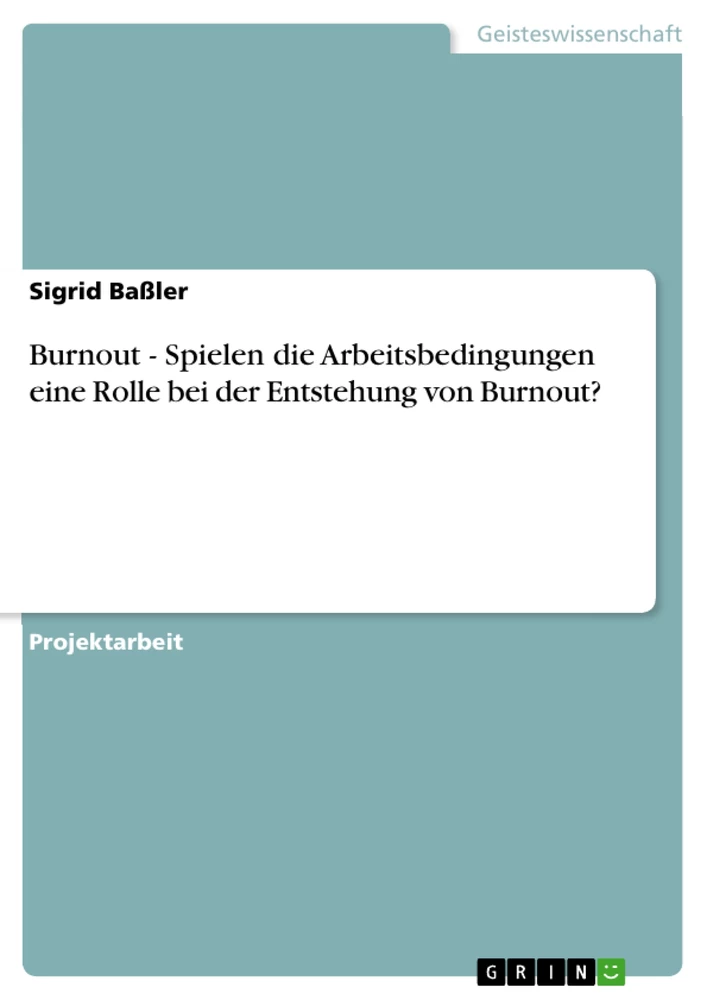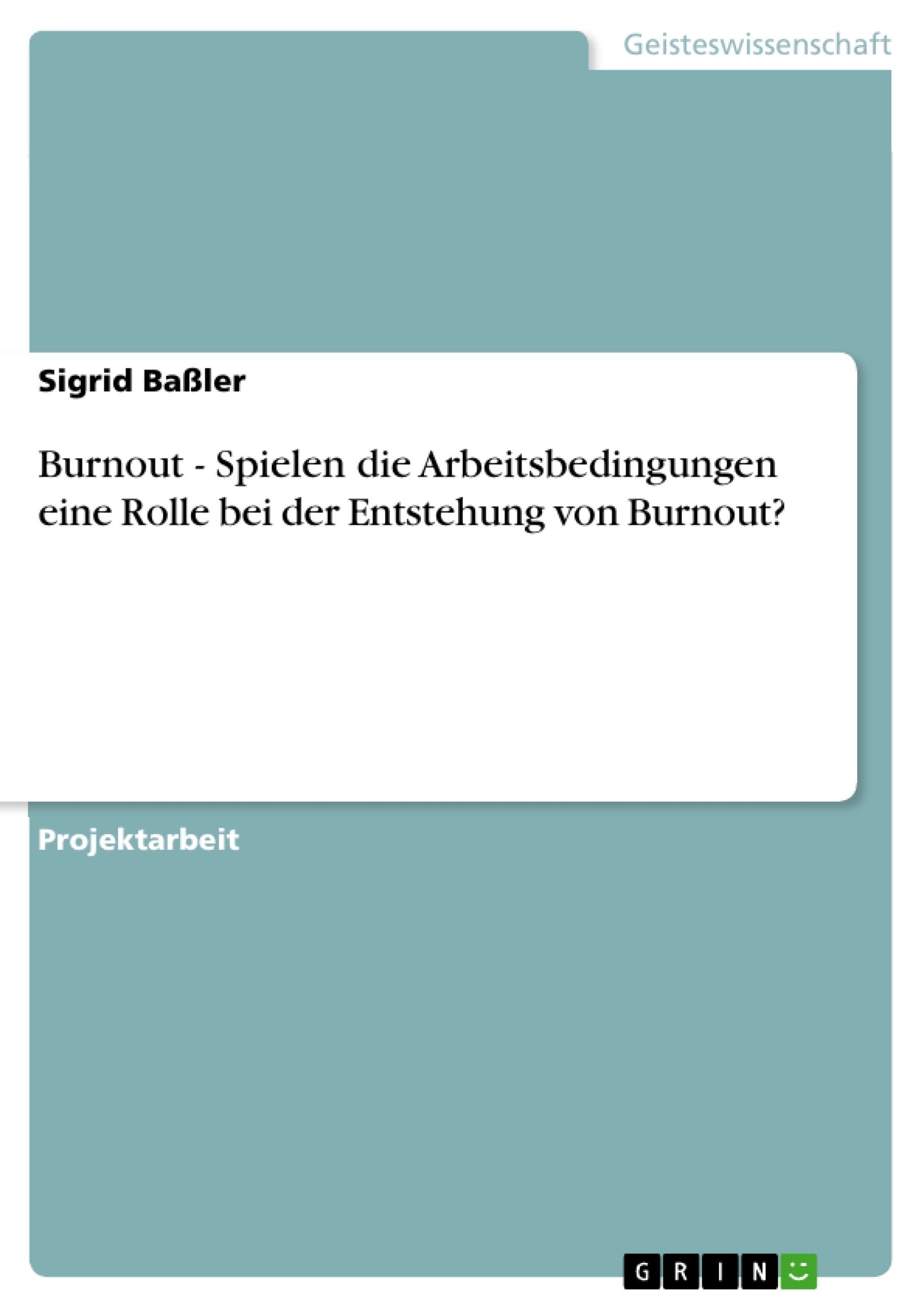„Wenn aus Feuer und Flamme Schutt und Asche werden“ mit diesen Worten leitete Stefan Poppelreuther seinen Vortrag auf der 1. Fachtagung „Psychische Belastungen im Beruf“ ein. Zahlreiche Menschen würden sich in der gegenwärtigen Arbeitssituation körperlich und emotional „ausgebrannt“ und leer fühlen. Populärwissenschaftlich würde dieser Erschöpfungszustand im Zusammenhang mit der Berufstätigkeit als „Burnout“ bezeichnet werden (Poppelreuther 2010 zit. nach Keuchen 2010: 88). Die Bedeutung von Burnout ist gewaltig: die Krankheitstage zwischen 2004 und 2010 sind lt. einer Pressemitteilung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK im April diesen Jahres wegen Burnout um nahezu das 9-fache gestiegen (WIdO 2011:1). Der gesamtwirtschaftliche Schaden ist also enorm. Zudem nahm die Häufigkeit der psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren immer mehr zu. Laut WIdO-Mitteilung seit 1999 sogar um 80%. Dabei treffe es Frauen und Menschen in erzieherischen und therapeutischen Berufen noch häufiger (WIdO 2011:1f). Nicht zuletzt aus ureigenstem Interesse ist es mir als Erzieherin an einem Frühförderzentrum deshalb wichtig mich mit dem Thema Burnout zu befassen. Es geht darum mich selbst gesund zu erhalten, die Qualität meiner Arbeit zu bewahren und meine Arbeitskraft zu sichern.
Auch im Hinblick auf meine zukünftige berufliche Rolle in der Sozialen Arbeit ist dieses Thema von Bedeutung: Einerseits wird es Teil meiner Aufgabe sein gesellschaftliche Bedingungen und Strukturen zu erkennen, mitzugestalten und Ursachen, welche krank machen, zu beseitigen (Keller/Novak 1993 zit. nach Reiners-Kröncke u.a. 2010: 63). Andererseits: wenn Menschen häufiger von Burnout betroffen sind, so gehören diese Menschen auch immer häufiger zu den Klienten der Sozialen Arbeit, z.B. im Bereich der Arbeitslosenberatung und im Bereich REHA/Wiedereingliederung in der klinischen Sozialarbeit. Auch Sozialarbeiter im Bereich der betrieblichen Sozialarbeit sollten sich mit dem Thema Burnout befassen, um evtl. betroffene Mitarbeiter rechtzeitig zu erkennen und auch präventiv beratend tätig werden zu können.
Ein weiterer Grund warum ich ein besonderes Interesse daran habe, mich mit dem Thema Burnout zu befassen sind meine Erfahrungen und Beobachtungen als Mitarbeiterin in einem Frühförderzentrum. Ich habe die Vermutung, dass die Arbeitsbedingungen (in der Sozialen Arbeit) eine nicht unerhebliche Rolle beim Entstehen von Burnout spielen. [...
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Bedeutung des Themas Burnout
1.2 Übersicht über die Arbeit
2 Grundlagen
2.1 Die Begriffe Burnout, Stress, psychische Belastung und Beanspruchung
2.2 Ursachen von Burnout
2.3 Symptome und Verlauf von Burnout
2.4 Erfassungsmöglichkeitenvon Burnout
3 Die Gefährdungsanalyse als präventive Maßnahme von Burnout
4 Fazit
5 Anhang
6 Literatur- und Quellennachweise