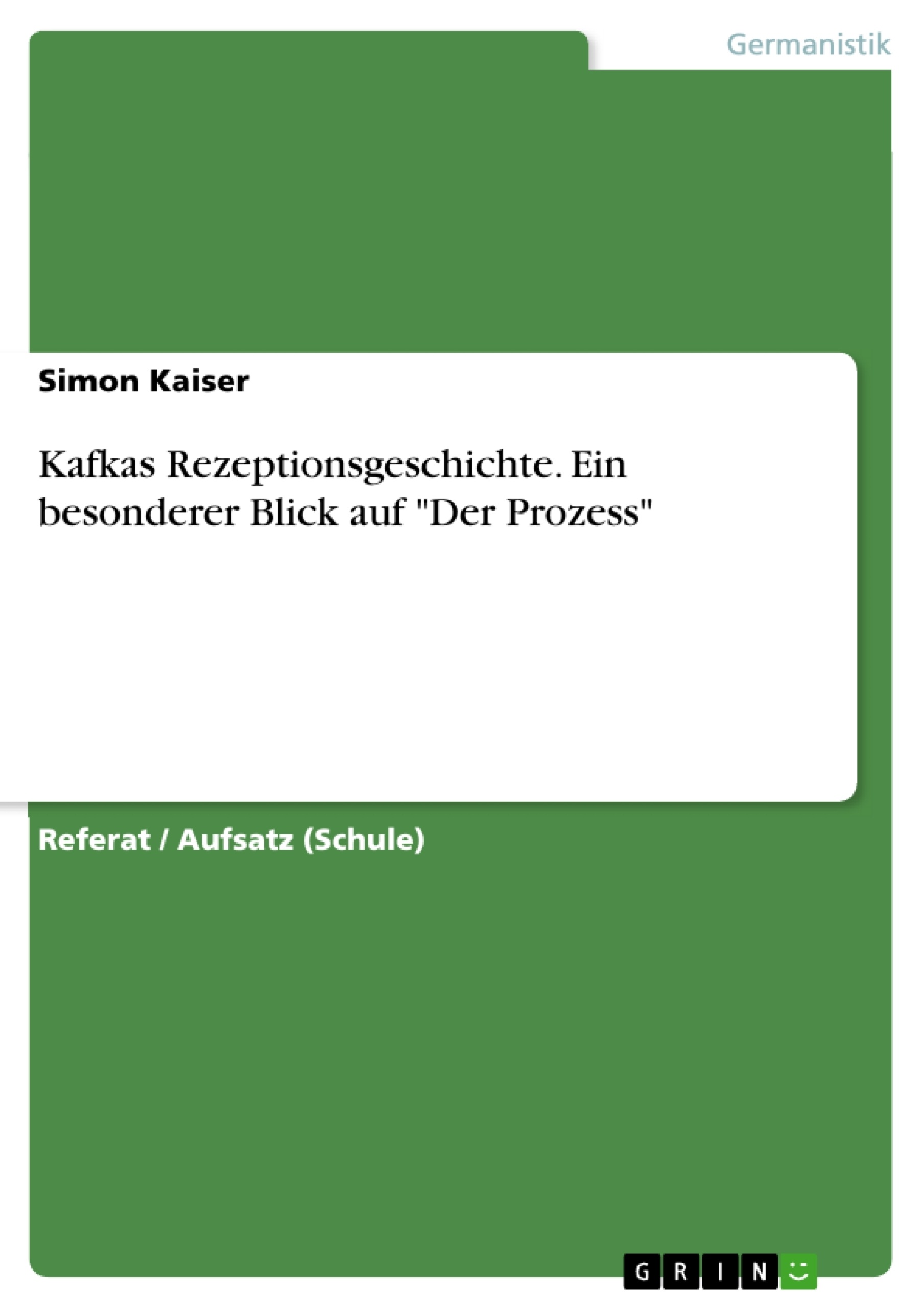Einführung
Laut Franz Kafka sollte ein Buch “die Axt sein, für das gefrorene Meer in uns”. Wohl kein anderes seiner Werke hat dieses Meer auf so eindrucksvolle Weise durchbrochen wie “Der Prozess”. Seit der Erstveröffentlichung 1925 entstanden unterschiedlichste Interpretationsansätze. Zu den fünf bekanntesten Ansätzen gehören der biographische, der psychoanalytische, der theologische, der existentialistische und der politische.
Um die Rezeptionsgeschichte des Romans empirisch untersuchen zu können, ist es notwendig neben diesen Ansätzen, auch examplarisch mit einigen Rezensionen bekannter Schriftsteller, sowie Zeitungsbesprechungen zu arbeiten.
Weiterhin sollen in dieser Arbeit drei Künstler vorgestellt werden, welche sich auf einen sehr großen Einfluss durch Kafka beriefen und schließlich soll der Einfluss Kafkas auf die Literaturgeschichte an sich untersucht werden.
Kafkas Rezeptionsgeschichte. Ein besonderer Blick auf "Der Prozess"
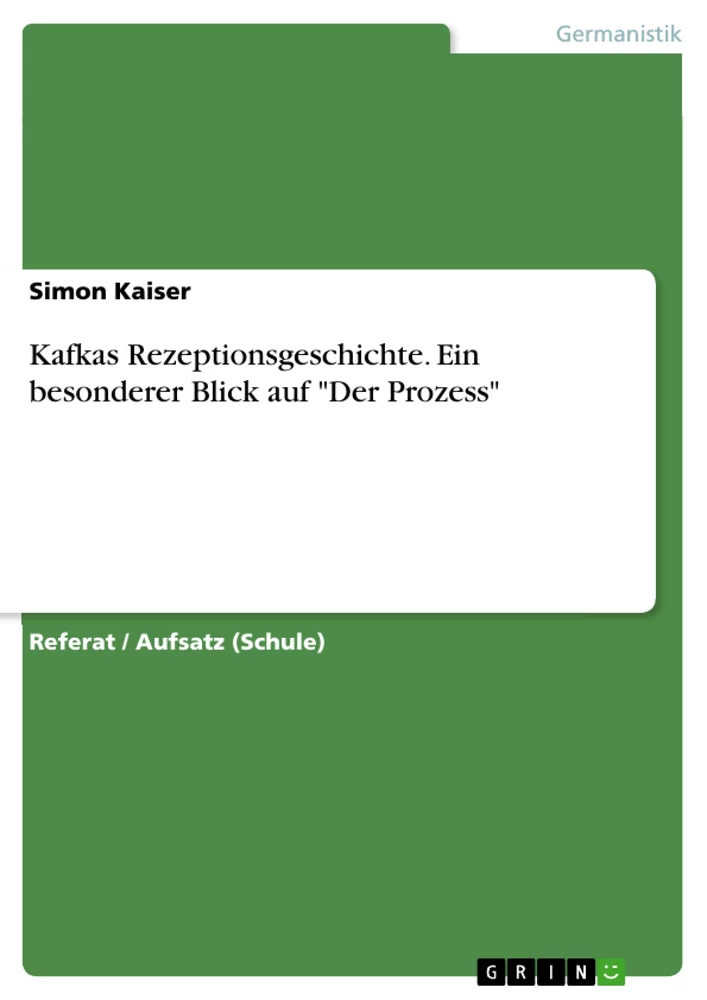
Referat / Aufsatz (Schule) , 2012 , 9 Seiten , Note: 15
Autor:in: Simon Kaiser (Autor:in)
Didaktik für das Fach Deutsch - Literatur, Werke
Leseprobe & Details Blick ins Buch