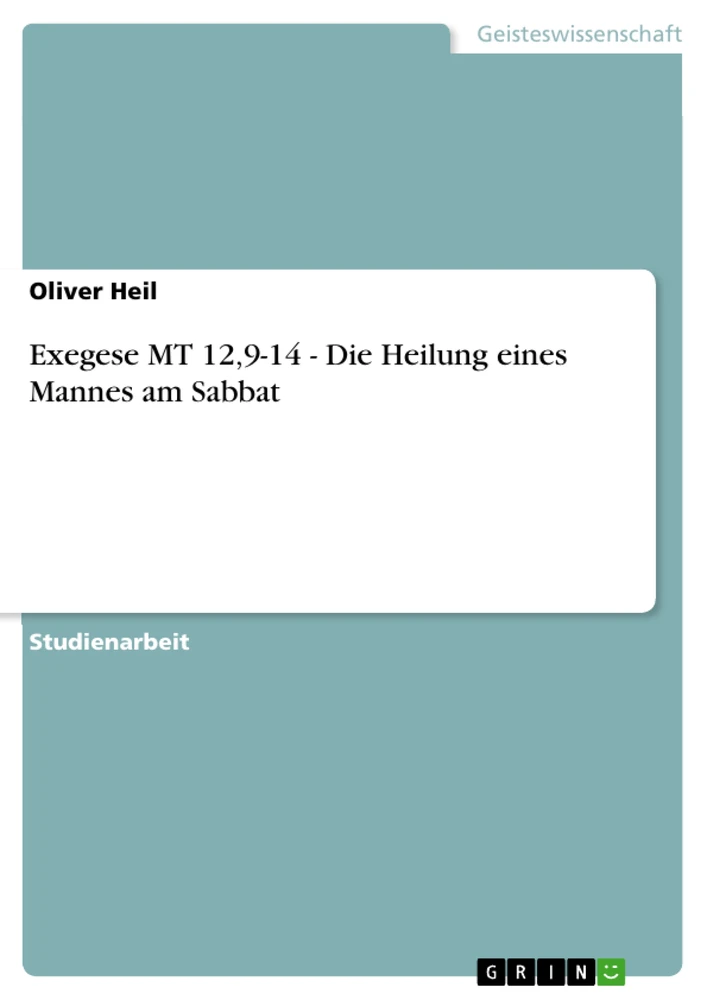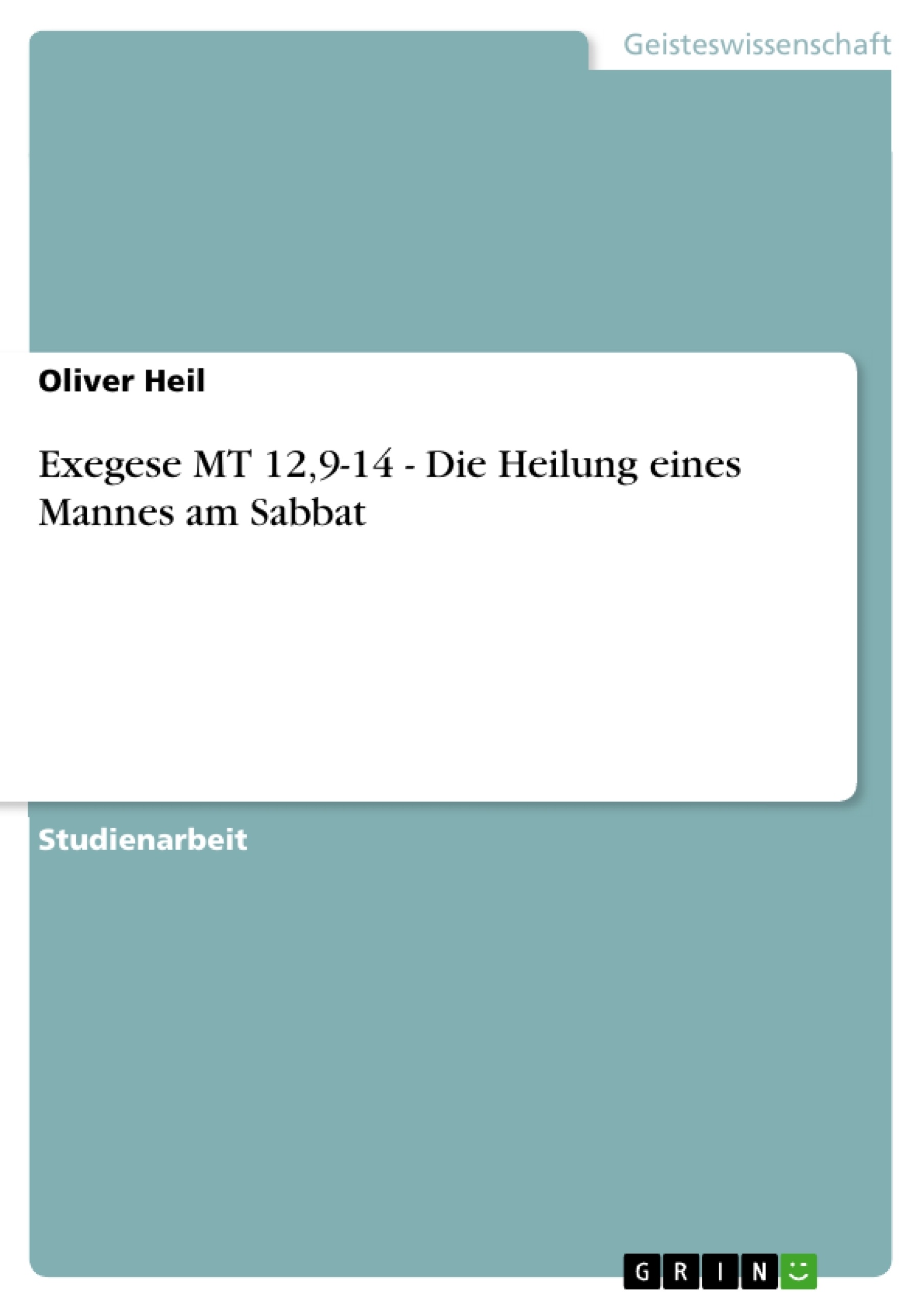Innerhalb des Matthäusevangeliums ist die Perikope in der ersten Hälfte positioniert, wobei sie von den Wundertaten Jesu, die ihr vorausgehen und den Gleichnissen, die ihr folgen, umschlossen wird.
Die Perikope von der Heilung der verdorrten Hand bildet den zweiten Teil des Streitgesprächszyklus über den Sabbat im Matthäusevangelium. Inhaltlich thematisieren beide Perikopen die Auslegung des Sabbatgesetzes. Während die erste Geschichte sich mit dem Pflücken von Ähren am Sabbat auseinandersetzt, thematisiert die zweite ein weitaus wichtigeres Problem, nämlich, ob es am Sabbat erlaubt ist, Menschen zu helfen. Im Aufbau des Matthäus Evangeliums leiten die Sabbatkontroversen zwischen Jesus auf der einen Seite und den Pharisäern auf der anderen Seite den verschärften Konflikt zwischen beiden Parteien ein.
Inhaltsverzeichnis
2. Literarkritik
2.1 Stellung im Kontext
2.2 Abgrenzung
2.3 Gliederung:
2.4 Literarische Einheitlichkeit
2.5 Synoptischer Vergleich
3. Formgeschichte
3.1 Die Gattung
3.2 Sitz im Leben
3.3 Rekonstruktion der Überlieferungsgeschichte
3.4 Traditionsgeschichte
3.5 Redaktionsgeschichte
4. Einzelauslegung
5. Biblisch Theologische Reflexion
6. Literaturverzeichnis
7. Internetquellen