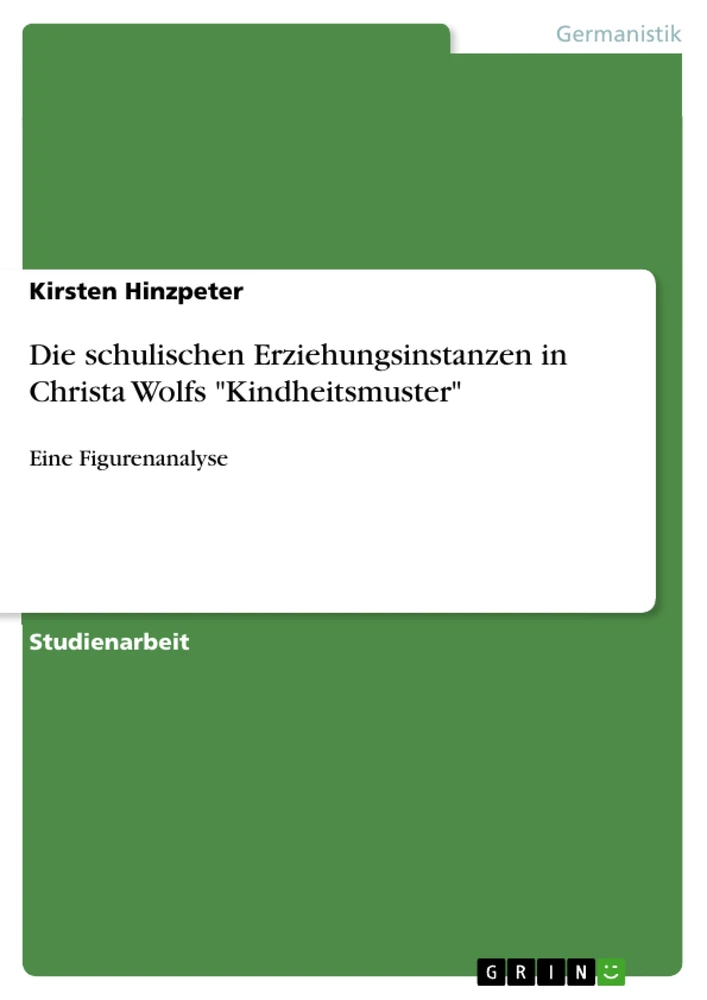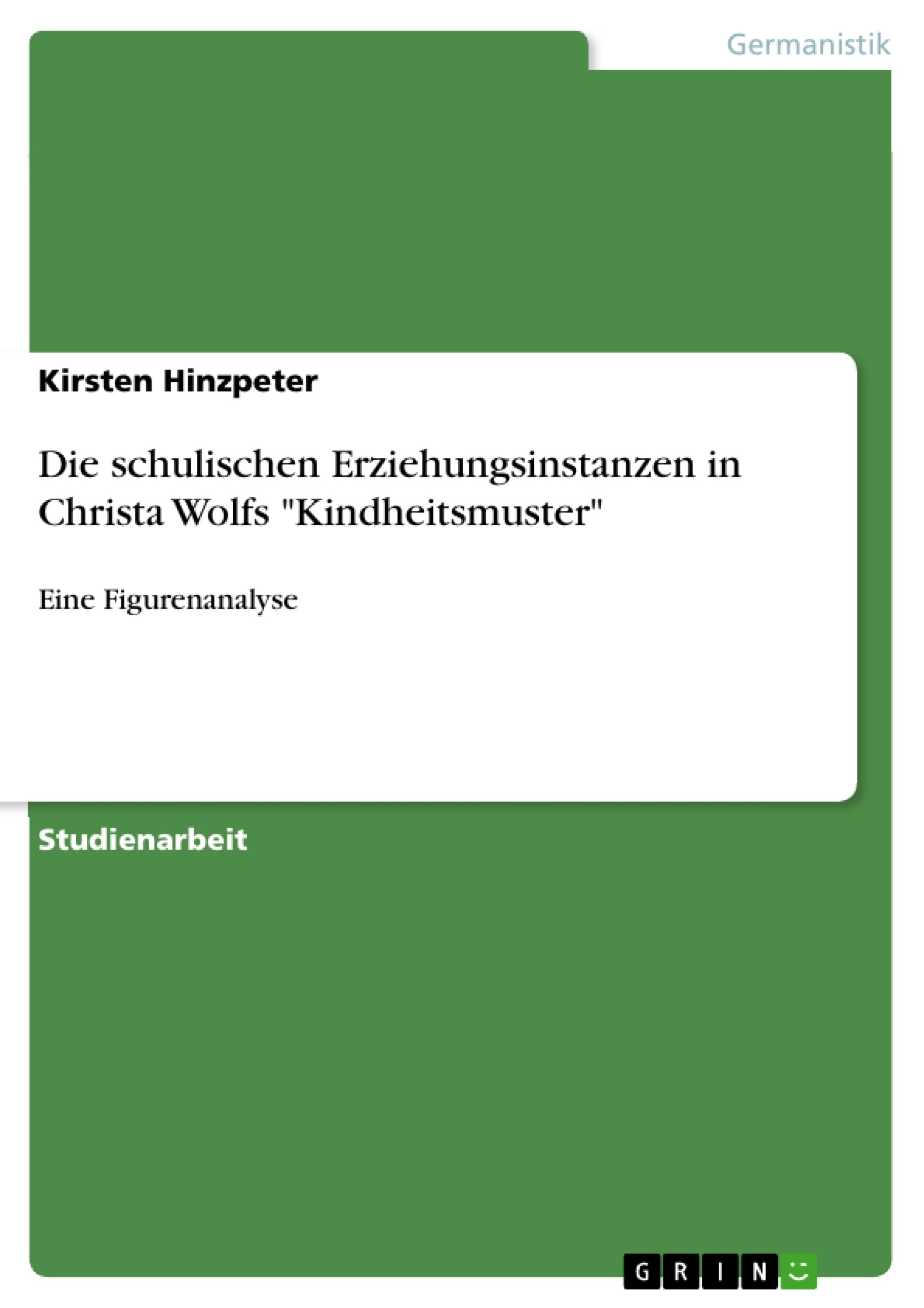Christa Wolfs Kindheitsmuster beschäftigt sich mit einem Erzähler-Ich, das 1929 in Deutschland geboren wurde und somit seine Kindheit im nationalsozialistischen Deutschland verbrachte. Im Gegensatz zu anderen Romanen, die sich mit dem zweiten Weltkrieg beschäftigen, setzt Kindheitsmuster demnach bereits mit der Kindheit des Erzähler-Ichs ein, nämlich etwa in dem Jahr 1932, in dem das Kind zum ersten Mal „Ich“ denkt. Der Fokus, der somit auch auf die Erziehung in den Vorkriegsjahren gelegt wird, legt es nahe, diese etwas genauer zu betrachten, um nachvollziehen zu können, mit welchen Erziehungsinstanzen Kinder im nationalsozialistischem Deutschland kon-frontiert waren und inwiefern diese ihre Entwicklung zu einem systemkonformen Bürger beeinflusst haben. In dieser Arbeit sollen demnach die schulischen Erziehungsinstanzen analysiert werden, um ihren Einfluss auf das Kind Nelly Jordan zu untersuchen. Um dieses reflektiert tun zu können, beschäftigt sich die Arbeit jedoch zunächst theoretisch mit der narratologischen Entität der Figur, um anschließend die Figuren des Lehrers Warsinski und der Lehrerin Dr. Juliane Strauch zu analysieren.
Inhalt
Einleitung
1. Die Figur
1.1 Eine kurze Einführung
1.2 Strukturalistische vs. mimetische Ansätze
1.2.1 Strukturalistische und formalistische Ansätze
1.2.2 Mimetische Ansätze
1.2.3 Versuche der Versöhnung der Ansätze
1.2.4 Figurenbegriff dieser Arbeit und Parameter der Figurenanalyse
1.3 Figurenanalyse und Mittel der Charakterisierung
2. Die Erziehungsinstanzen in Christa Wolfs Kindheitsmuster – Eine Figurenanalyse
2.1 Die Besonderheiten des Romans
2.2 Herr Warsinski – Mädchenschule III
2.3 Dr. Juliane Strauch - Oberschule
Fazit