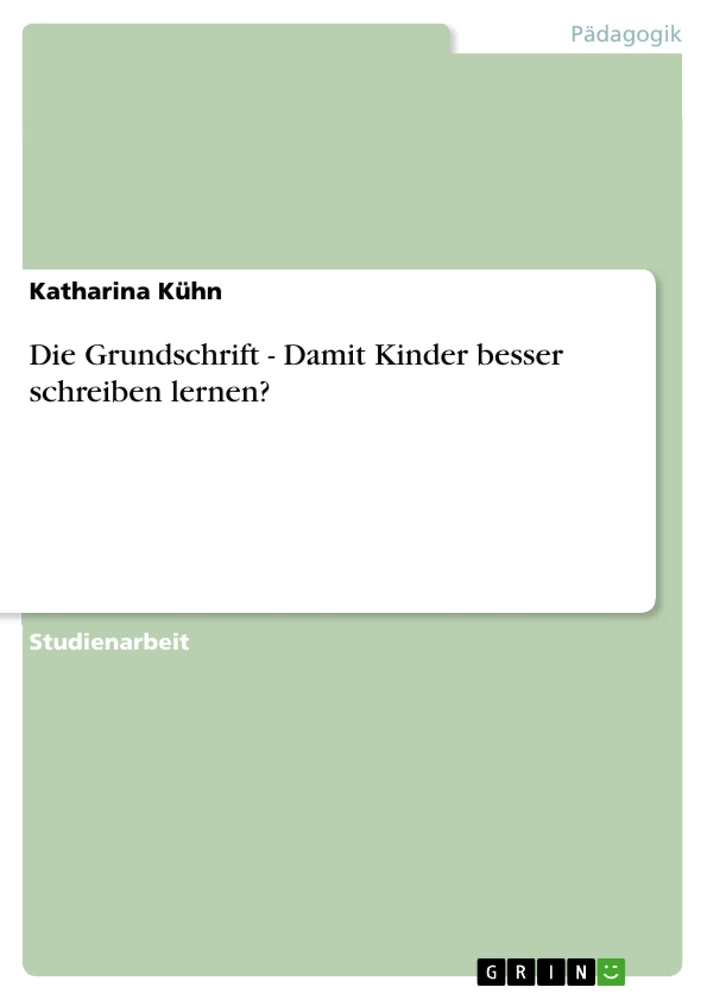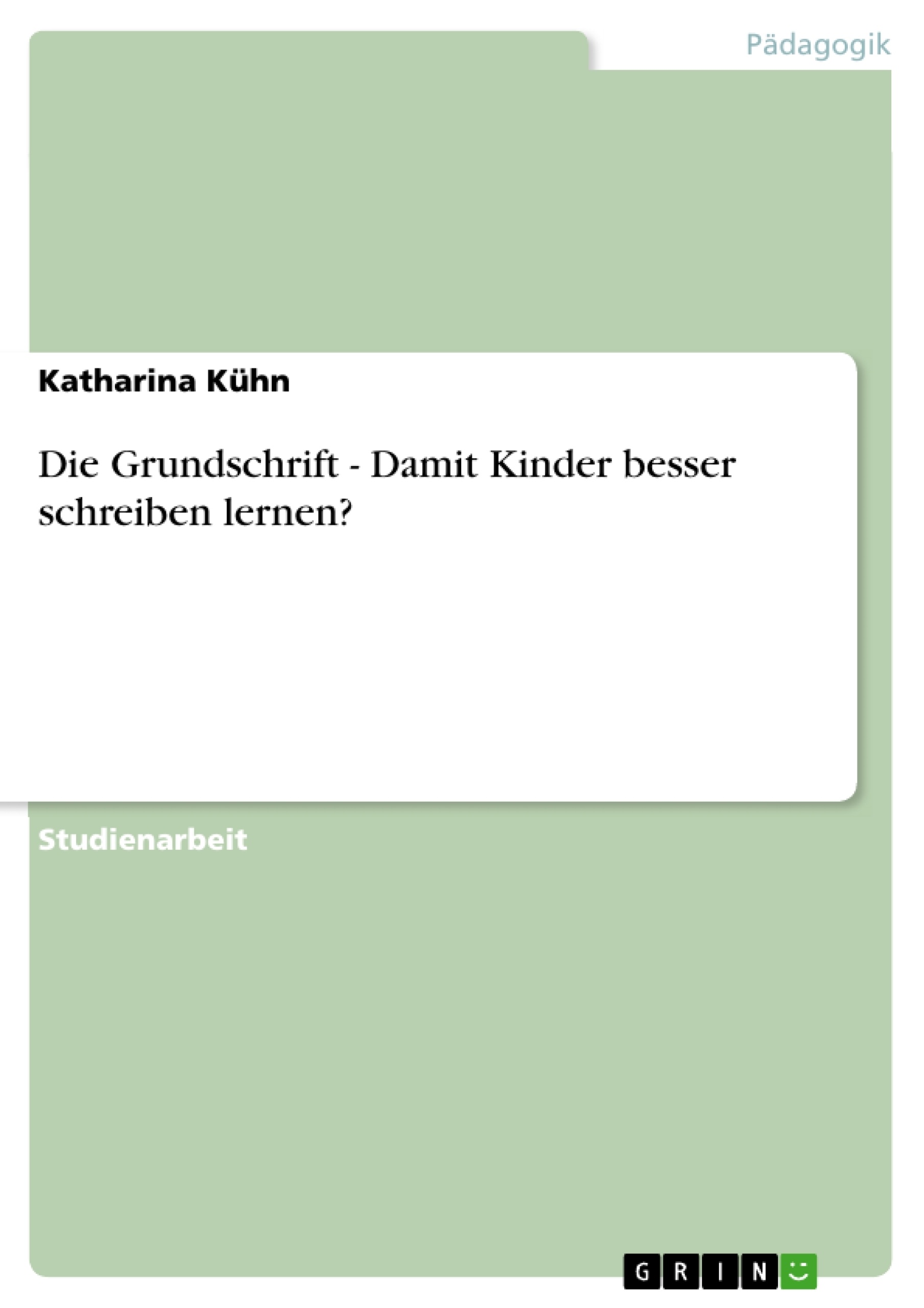Die Diskussion um die Ausgangsschriften ist groß und offensichtlich jederzeit aktuell.
Dies bestätigt auch die aktuelle Veröffentlichung des Grundschulverbandes „Grundschrift. Damit Kinder besser schreiben lernen“, herausgegeben von Horst Bartnitzky, Ulrich Hecker und Christina Mahrhofer-Bernt (vgl. Bartnitzky/ Hecker/ Mahrhofer-Bernt 2011). Dieser Band stellt die neu entwickelte „Grundschrift“ vor, die kurz gesagt eine handgeschriebene Druckschrift ist und den Verzicht auf eine normierte Ausgangsschrift ermöglichen soll.
Wie genau diese Schrift aussieht und wie sie sich von den anderen Schriften unterscheidet, wird in der vorliegenden Arbeit untersucht. Hierfür werden zunächst allgemeine Grundlagen zum aktuellen Stand der Ausgangsschriften gegeben, um den Unterschied zur Grundschrift zu verdeutlichen. Anschließend werden Beweggründe aufgeführt, die zur Entstehung dieses neuen Modells geführt haben, bevor das Modell an sich vorgestellt wird. Ergänzend dazu wird ebenso beleuchtet, wie sich die Herausgeber der Grundschrift deren Einbindung in den Schulalltag vorstellen.
Da die Grundschrift bereits jetzt – erst kurze Zeit nach ihrer Veröffentlichung – zu ausführlichen Diskussionen führt, gewährt ein anschließendes Kapitel Einblick in das aktuelle Medienecho. Hierdurch wird untersucht, welche Aspekte Befürworter und Gegner der Grundschrift zu ihren jeweiligen Meinungen bringen, um letzten Endes gegebenenfalls eine eigene Meinungsbildung zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Schrift in der Welt der Kinder
2.1. Die Diskussion um die Ausgangsschriften
2.2. Was sagen Rahmenplan und Bildungsstandards?
3. Die Grundschrift
3.1. Hintergründe zur Entstehung
3.2. Das allgemeine Konzept der Grundschrift
3.3. Aufbau des Modells
3.4. Die Grundschrift im Schulalltag
4. Das Medienecho
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
7. Abbildungsverzeichnis
8. Anlagen
a. PISA-Studie 2009
b. Die Ausgangsschriften im Vergleich.
c. Die Bewegungsgruppen der Grundschrift
d. Selbsteinschätzungs- und Rückmeldebogen
e. Pressemitteilung des Grunschulverbandes