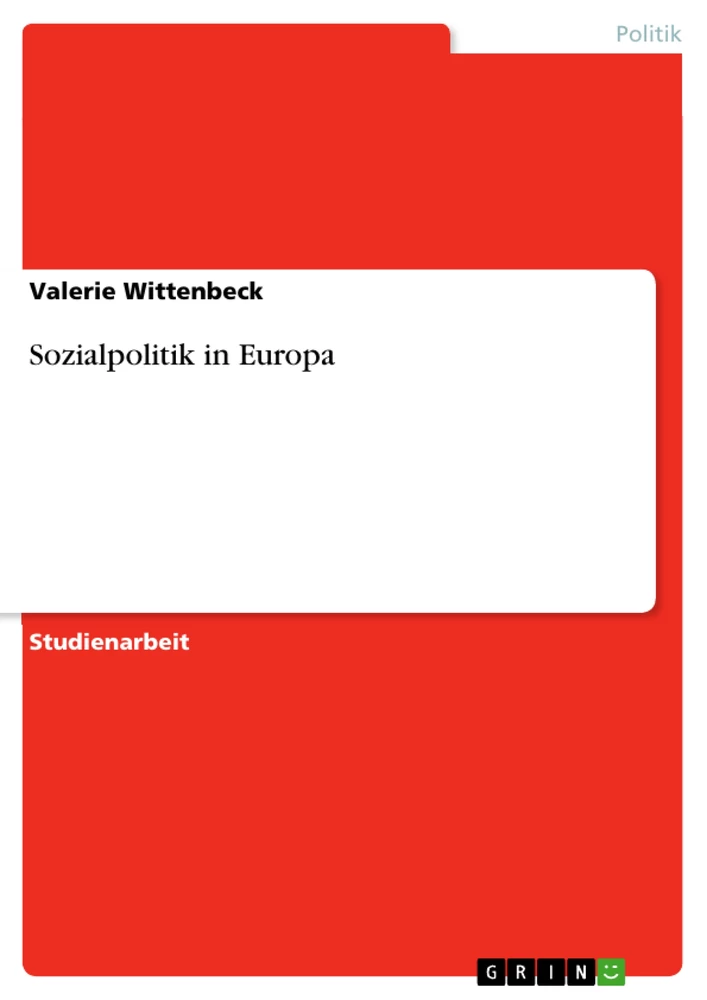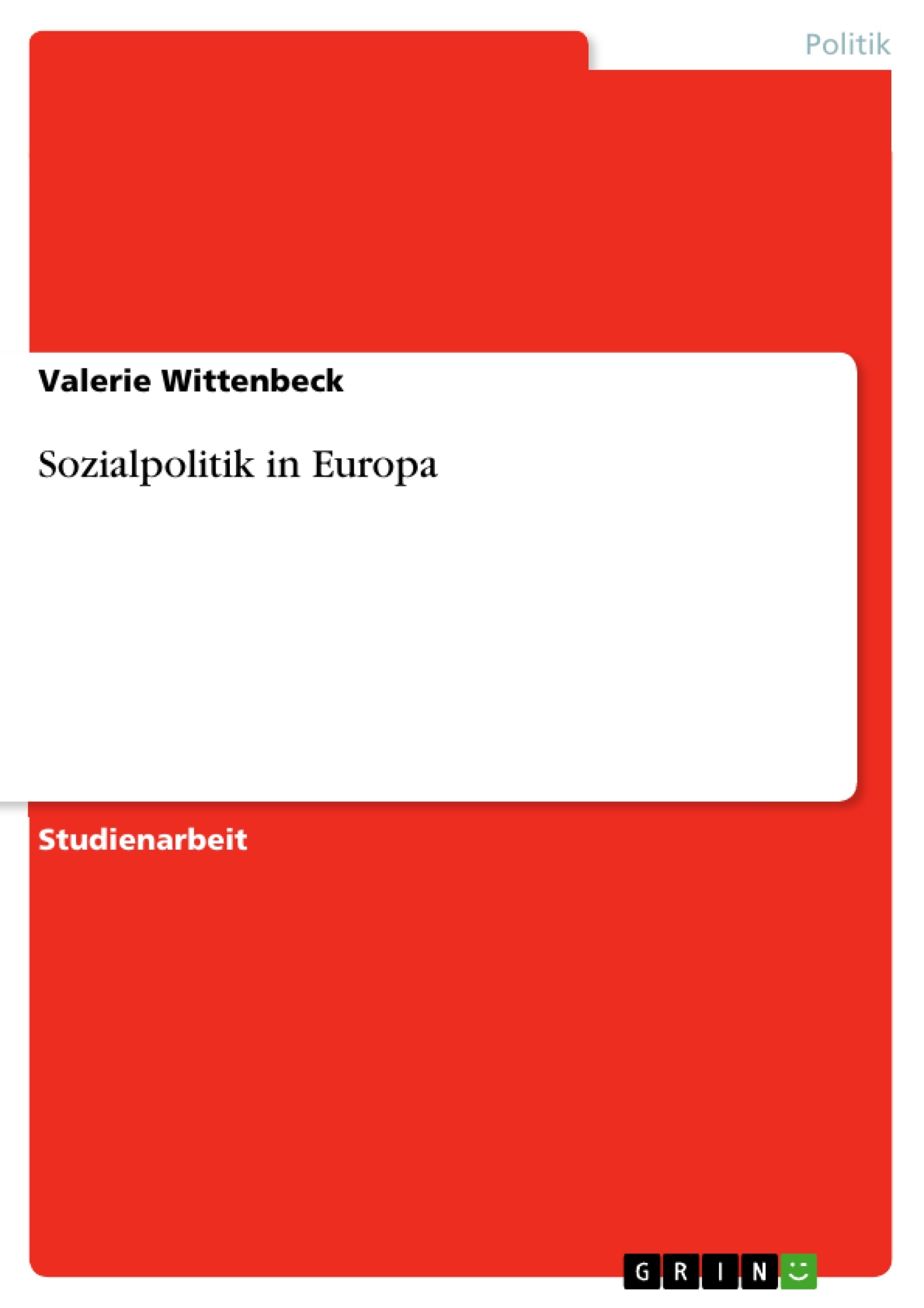Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich die historische Entwicklung der europäischen Sozialpolitik darzustellen und dabei einige für das Feld der Sozialpolitik relevanten Verträge näher beleuchten. Außerdem der Frage nachzugehen inwieweit es möglich ist sozialpolitische Ziele mit den vorhandenen Instrumenten zu erreichen.
Gliederung
1. Einleitung
2. Begriffsdefinitionen
3. Geschichtlicher Rückblick
3.1 Sozialcharta
3.2 Sozialpolitisches Aktionsprogramm
3.3 Die Einheitliche Europäische Akte
3.4 Gemeinschaftscharta der soziale Grundrechte der Arbeitnehmer
3.5 Der Vertrag von Maastricht
3.6 Das Weißbuch der Sozialpolitik
3.7 Amsterdamer Vertrag
3.8 Charta der Grundrechte der Europäischen Union
4. Ziele der europäischen Sozialpolitik
5. Grundlagen der europäischen Sozialpolitik
5.1 Die institutionellen Akteure der EU
5.2 Rechtliche Grundlagen der Sozialpolitik
5.3 Instrumente der europäischen Sozialpolitik
6. Fazit
Literaturverzeichnis