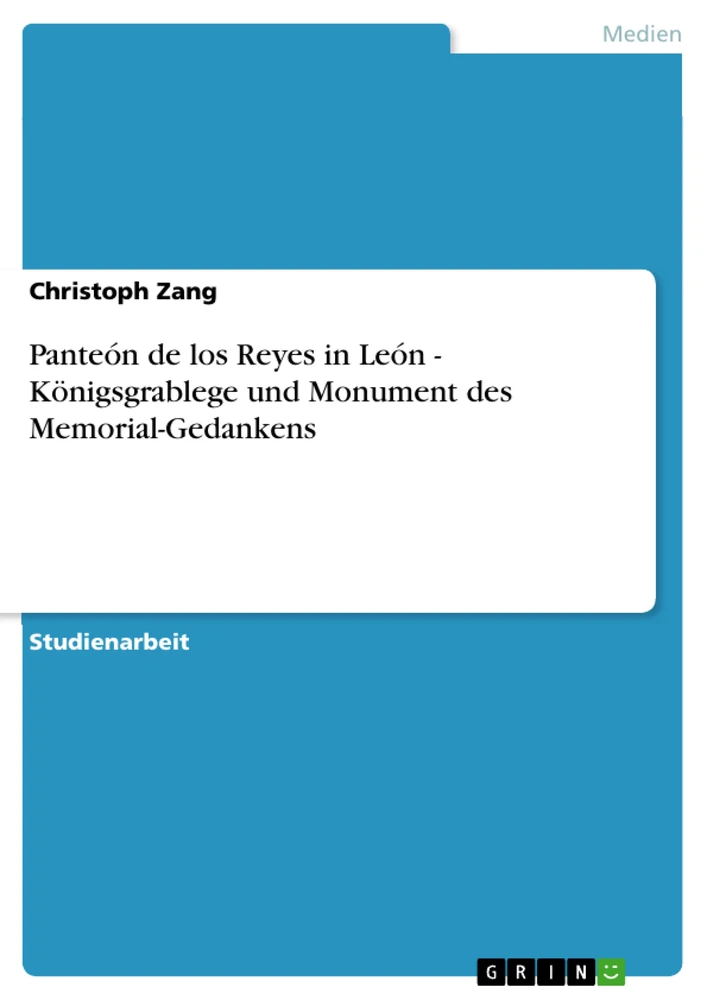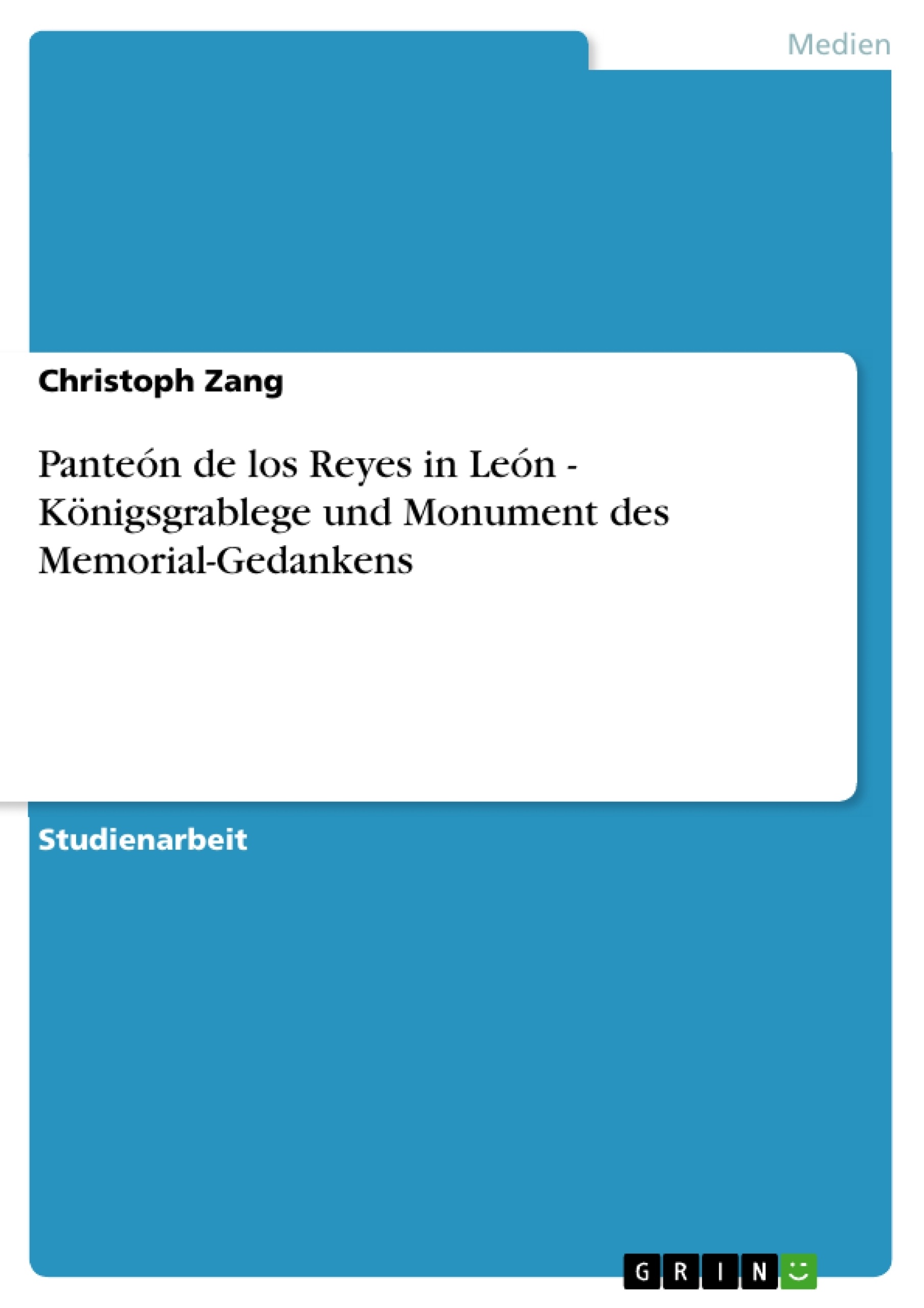Das Panteón de los Reyes in León, Spanien, ist ein Annexbau in Form einer Grablege, der der heutigen Kollegiatskirche San Insidoro im Westen vorgelagert ist. Seinerzeit fungierte diese als Krönungskirche des kastilisch-leonesischen Herrscherhauses.
Sicher zu dieser ist königlichen Grablege ist heute, „[…] daß sich alles in Revision befindet, […]“ und „[…] daß die Bewertung des Kunstwerks im Laufe der Jahrunderte sehr unterschiedlich war.“
Diese Arbeit soll einen Teil der umfangreichen Diskussionen aufgreifen und ihren kontroversen Charakter veranschaulichen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Geschichtlicher Hintergrund des Panteón de los Reye
2.1 Vorgängerkirche León I
2.2 San Isidoro in León
3. Bestand und Erhaltungszustand des Panteón de los Reye
3.1. Architektur und Konstruktion
3.2. Bauskulptur und Dekoration
3.3. Malereizyklus
4. Das Panteón de los Reyes in León: Produkt mehrerer Bauphasen oder geplantes Monument?
4.1. These einer Bauphase und Datierung um das Jahr
4.2. These mehrerer Bauphasen und Datierung nach
5. Schlussbemerkung Fazit und Forschungsausblick
6. Literaturverzeichnis
7. Abbildungsverzeichnis
8. Bild-Anhang